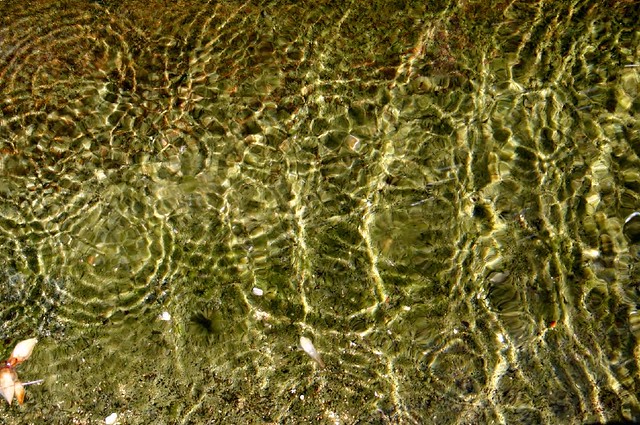Heute tagt die grüne BAG Medien & Netzpolitik in Berlin. Da ich andere Termine hatte und nicht teinehmen konnte, hatte ich heute morgen – mehr scherzhaft – danach gefragt, ob die BAG-Sitzung denn gestreamt wird. Wird sie erwartungsgemäß nicht, und, an die eigene Nase gefasst, auch „meine“ BAG Wissenschaft, Hochschule, Technologiepolitik nächstes Wochenende wird voraussichtlich ohne Stream auskommen. Ja, schlimmer noch: Wenn ich drüber nachdenke, finde ich es ganz gut, wenn Parteiarbeitsgruppen zwar mitgliederöffentlich, aber eben doch in einem einigermaßen geschützten Raum tagen.
Ähnlich wie bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze ist es vermutlich allein schon die Ankündigung, dass gestreamt wird, die mehr oder weniger subtil das Verhalten Einzelner beeinflusst. Kurz: Ich glaube, dass unter Ausschluss der virtuellen Öffentlichkeit offener geredet wird, dass über noch „geheime“ Dinge informiert wird, die z.B. aus Sicht der Bundestagsfraktion andere Fraktionen noch nicht mitbekommen sollen, dass in den Länderberichten nicht nur Erfolgsmeldungen auftauchen, sondern auch Selbstkritik. Und ich glaube, dass all das anders wäre, wenn die breite Netzöffentlichkeit dabei wäre, sich vielleicht sogar einmischen könnte.
Wichtig ist mir, dass dieses Argument kein generelles Argument gegen die (gestreamte) Öffentlichkeit von Sitzungen ist. Ich finde es gut, dass unsere Parteitage offen für alle sind und im Netz übertragen werden. Gleiches gilt für die Landtagssitzungen oder für Gemeinderatssitzungen (derzeit in Baden-Württemberg ein heißes Thema, weil der Datenschutzbeauftragte das Livestreaming verboten hat, solange es dafür keine explizite Gesetzesgrundlage gibt).
Bei Ausschusssitzungen bin ich ambivalent. Die sind in Baden-Württemberg derzeit generell nicht-öffentlich und werden nur in Ausnahmefällen (etwa bei Anhörungen) geöffnet. Da hier gewählte VolksvertreterInnen stellvertretend für alle debattieren, wäre ich prinzipiell dafür, sie öffentlich zu machen. Allerdings befürchte ich, dass das in der Tat Veränderungen der Diskussionskultur hin zu noch mehr Schaufenster und noch weniger Sachargumentation mit sich bringt.
Damit wird auch deutlich, dass das Problem tiefer liegt: Parlamentssitzungen sind zwar öffentlich, die eigentlichen Entscheidungen fallen aber anderswo. Die dort vorgetragenen Argumente richten sich damit weniger an die anderen Abgeordneten als vielmehr an die Öffentlichkeit. Sie dienen der Selbstpositionierung, sie dienen dazu, Gesetze und Themen mit zugespitzten Botschaften zu verknüpfen. Wie abgestimmt wird, entscheidet sich in den Arbeitskreisen der Fraktion, eventuell in der Fraktionssitzung – beides geschlossene Orte. Und wie die Regierungsfraktionen handeln, hat auch etwas damit zu tun, was im Kabinett entschieden wird (und andersherum) – wiederum ein Ort höchster Verschwiegenheit.
Um zurück zu den Sitzungen grüner Bundesarbeitsgemeinschaften zu kommen: Wenn die relevant für die Weiterentwicklung der innerparteilichen Meinungen sind, dann funktionieren sie nur, wenn Abgeordnete dort offen reden können. Die wiederum sind – von Land zu Land unterschiedlich, m.E. in den Ländern mit Regierungsbeteiligung ganz besonders ausgeprägt – aber an die Kultur der nur zu besonderen Anlässen geöffneten Türen gewöhnt. Und handeln danach.
Vertraulichkeit hat nicht ohne Grund etwas mit Vertrauen und mit Vertrautheit zu tun. Bisher vertrauliche Meinungsbildungsprozesse transparent zu machen (Ergebnisse sind noch einmal eine andere Frage), ist in einer „intransparent society“ ein potenzieller Vertrauensbruch. Und deswegen sehr viel weniger einfach umzusetzen, als es die plakativen Piratenforderungen und die technischen Möglichkeiten suggerieren.
P.S.: Extrembeispiel für die weitere Debatte: die Forderung der Piraten, Koalitionsverhandlungen zu streamen.
Warum blogge ich das? Weil diese Gedanken – die nicht abgeschlossen sind – schlecht in 140 Zeichen passen. Dank an @sebaso, @neina_hh, @themroc, @christiansoeder und @mrtopf für Anregungen auf Twitter.