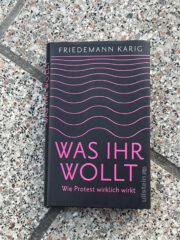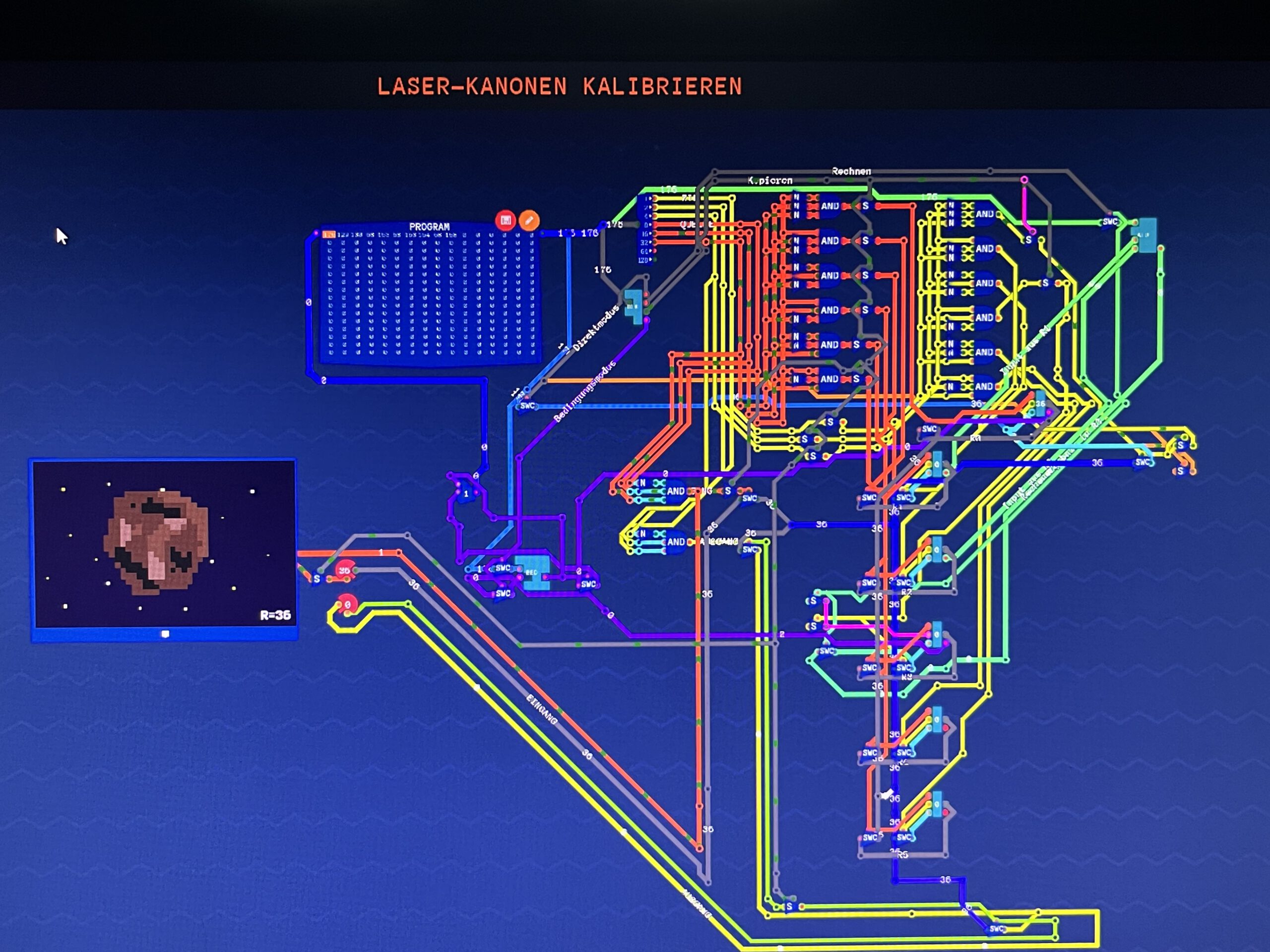Ich gebe zu, dass ich bei dem Thema etwas voreingenommen bin. Eine von den Dingen, die ich wirklich aus meinem Soziologiestudium mitgenommen habe, ist Praxistheorie: gesellschaftliche Regeln, Erwartungen usw. verfestigen sich, indem sie immer wieder wiederholt werden – und damit Bahnen schlagen für genau diese Regeln und Erwartungen. Es ist so, weil es schon immer so war. Soziale Strukturbildung ist fluide. Jetzt kommt Technik ins Spiel: in Infrastruktur und Artefakte gegossene Erwartungen sind sehr viel fester als bloße soziale Erwartungsbündel und tragen dazu bei, diese über die Zeit festzuschreiben. Bis hin zu kontingenten Entscheidungen, die heute extremen Einfluss darauf haben, was wir glauben zu tun zu können und was nicht. Egal, ob es das Layout von Tastaturen ist oder die Spurweite der Eisenbahn oder die Orientierung ganzer Städte auf das Auto. Mit Elizabeth Shove gesprochen: soziale Praktiken bestehen aus einer Trias aus Skills/Handeln, Bildern/Vorstellungen/Wissen und eben Artefakten. Was ich sagen will: das Wechselspiel zwischen Infrastruktur und sozialer Strukturbildung fasziniert mich.
Ich gebe zu, dass ich bei dem Thema etwas voreingenommen bin. Eine von den Dingen, die ich wirklich aus meinem Soziologiestudium mitgenommen habe, ist Praxistheorie: gesellschaftliche Regeln, Erwartungen usw. verfestigen sich, indem sie immer wieder wiederholt werden – und damit Bahnen schlagen für genau diese Regeln und Erwartungen. Es ist so, weil es schon immer so war. Soziale Strukturbildung ist fluide. Jetzt kommt Technik ins Spiel: in Infrastruktur und Artefakte gegossene Erwartungen sind sehr viel fester als bloße soziale Erwartungsbündel und tragen dazu bei, diese über die Zeit festzuschreiben. Bis hin zu kontingenten Entscheidungen, die heute extremen Einfluss darauf haben, was wir glauben zu tun zu können und was nicht. Egal, ob es das Layout von Tastaturen ist oder die Spurweite der Eisenbahn oder die Orientierung ganzer Städte auf das Auto. Mit Elizabeth Shove gesprochen: soziale Praktiken bestehen aus einer Trias aus Skills/Handeln, Bildern/Vorstellungen/Wissen und eben Artefakten. Was ich sagen will: das Wechselspiel zwischen Infrastruktur und sozialer Strukturbildung fasziniert mich.
Genau da setzt Deb Chachras Buch How Infrastructure Works. Inside the Systems That Shape Our World (2023) an. Chachra – eine Professorin für Materialwissenschaft – beginnt (wie im ganzen Buch mit einem sehr lakonischen, anspielungsreichen und auch vor Wortspielen nicht zurückschreckenden Stil) mit einer Einführung, was Infrastrukturen überhaupt sind, wie es dazu kommt, dass es sie gibt, und wie Infrastrukturen aufeinander aufbauen. Und schon ziemlich früh in ihrem Buch macht sie klar, dass Infrastruktur eben auch etwas mit Macht zu tun hat, und ohne soziale Einbettung – und ohne soziale Wirkung – überhaupt nicht denkbar ist. Besonders an dem Buch ist zudem die vielfältige Perspektive. Chachra ist die Tochter von nach Kanada eingewanderten Inder*innen, und sie lebt inzwischen in den USA, zwischenzeitlich in Großbritannien. Das sind die Kontrastfolien, die immer wieder auftauchen.
Was im ersten Teil eher wie eine gute geschriebene Einführung in die Geschichte von Wasser, Gas, Elektrizität (und Verkehr) wirkt, wird dann schnell zu einem politischen Buch. Die Infrastruktur, die wir als gegeben hinnehmen, und die ein Ergebnis (und eine Grundlage) der Akkumulation von Reichtum in den westlichen Gesellschaften darstellt, ist ohne lange Handlungsketten, ohne Ausbeutung des globalen Südens, nicht denkbar. Infrastruktur ist in soziale und politische Systeme eingebettet und perpetuiert diese.
Oder, um es in zwei Zitate zu packen: „Infrastructural networks, by their nature, increase individual freedom collectively.“ (S. 115) – „Infrastructural networks could be fairly described as vast constructions whose purpose is to centralize resources and agency to a small fraction of extremely priviledged humans and to displace the harms to many others.“ (S. 134)
Chachra geht nun darauf ein, wie Infrastruktur „fails“ (fehlschlägt, kaputt geht – ich finde, das lässt sich nicht so richtig gut übersetzen). Das sind nämlich nicht nur Terroranschläge etc., sondern insbesondere auch langsam anwachsende Wartungsprobleme, weil zum Beispiel kein Geld da ist, um Brücken zu sanieren. Diese Art von Problemen nennt Chachra in Abgrenzung von „black swans“ und „gray swans“ dann „red termites“ – lästig, fast unsichtbar, gut ignorierbar, und irgendwann stürzt die Brücke dann ein. („Any sufficiently advancded negliegence is indistinguishable from malice.“ (S. 161))
Funktionierende Erhaltung von Infrastruktur hat wiederum sehr viel damit zu tun, wie diese politisch eingebettet ist – geht es darum, einen Profit zu erwirtschaften, oder steht das Allgemeinwohl im Vordergrund? Wie viel Geld wird zur Verfügung gestellt, und wie wird die scheinbar so langweilige Routinearbeit der Überprüfung und Instandsetzung bewertet?
Neben Schwänen und Termiten taucht dann auch ein „gray rhino“ auf – das graue Nashorn, das längst im Raum steht, und gerne ignoriert wird, egal, wie es sich benimmt: der Klimawandel. Das es diesen gibt, hat viel mit Infrastruktur zu tun – im Bau und Betrieb von Infrastruktur steckt Energie, und die ist für die letzten 200 Jahre vor allem fossile Energie. Gleichzeitig führt der Klimawandel dazu, dass Infrastruktur Problemen ausgesetzt ist, die bisher unvorhergesehen sind. Jahrhundertstürme und ‑hochwasser häufen sich, Temperaturen schwanken über Bereiche hinaus, für die Straßen oder Stromleitungen vorgesehen sind. Der Klimawandel trägt also dazu bei, dass unsere für selbstverständlich hingenommene Infrastruktur schneller und schneller bröckelt und repariert und angepasst werden muss.
Wie das geschehen kann – und damit schlägt Chachra dann den ganz großen Bogen – wird in den letzten Kapiteln des Buchs ausgeführt, in dem sie eine Zukunftsvision zeichnet. Die besteht nicht aus glitzernder Hightech, sondern baut auf einer dezentralisierten, flexiblen und resilienten Grundlage auf. Das mag langweilig wirken, ist aber eine sehr viel konkretere Utopie. Aus einer Einführung in die Politik der Infrastrukturen wird hier ein gut begründetes politisches Manifest, das in sechs Handlungsmaximen mündet:
- Plan for Abundant Energy and Finite Materials
- Design for Resilience
- Build for Flexibility
- Move Toward an Ethics of Care
- Recognize, Prioritze, and Defend Non-monetary Benefits
- Make It Public
Das scheinen mir sehr gute Orientierungsplanken zu sein – und zwar ganz egal, ob es um Verkehrssysteme, Städteplanung, Kommunikationssysteme, Elektrik oder die Wasserver- und ‑entsorgung geht. Die Zusammenhänge, die Chachra zwischen Nachhaltigkeit im Sinne von Dauerhaftigkeit, einer gewissen Nutzungsflexibilität und dem Fokus auf Resilienz auf macht, erscheinen sehr plausibel. Dazu gehört auch der inhärente Widerspruch zwischen Optimierung/Effizienz einerseits und Resilienz andererseits. Ein System, das mit Änderungen seiner Umwelt, mit Problemen und Störungen klar kommen soll, braucht eine gewisse Redundanz, braucht „slack“. Und genau die fällt weg, wenn das System bis zum letzten Winkel auf Effizienz getrimmt wird.
Ganz nebenbei räumt Chachra hier in gelungener Weise mit dem Mythos auf, dass der individuelle Fußabdruck, wie ihn BP erfunden hat, ein hilfreiches Maß ist. Entscheidend sind die großen technischen Systeme, weil diese nicht nur unser Handeln ermöglichen und lenken, sondern in deren Bau und Betrieb auch der Löwenanteil unserer CO2-Emissionen steckt.
Insgesamt also ein rundum empfehlenswertes Buch, nicht nur für Nerds, sondern für alle, die eine Handlungsanleitung für den Umbau der technischen Welt, in der wir leben, brauchen können.