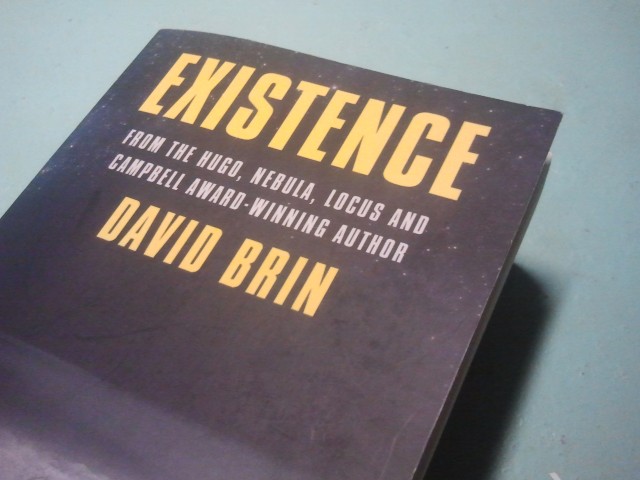
Gute Vorsätze, da war doch was. Genau: Ich habe mir vorgenommen, häufiger über das, was ich lese, zu schreiben. Das betrifft vor allem Science Fiction. Nicht mit dem Anspruch einer hochwertigen Kritik von vorne bis hinten, und auch nicht immer, aber dafür öfter. Zu dem, was mir so aufgefallen ist beim Lesen, und was nach dem Lesen hängengeblieben ist.
Ich fange mal mit David Brins 2012 erschienenem Roman Existence an, der mich mehrere Nächte dazu verleitete, viel zu lange wach zu bleiben. Brin ist einer der esoterischeren Hard-SF-Autoren; seine Bücher sind – wie es sich für einen akademisch tätigen Astrophysiker gehört – zunächst wissenschaftsnah und sehr realistisch, fangen aber irgendwann an, extrem spekulativ zu werden (wenn auch nicht in dem Ausmaß wie bei Greg Egan). Trotzdem gefällt mir die erste Hälfte des um die 650 Seiten umfassenden Werkes Existence deutlich besser als die zweite Hälfte. Gleich mehr dazu, warum, aber zunächst ein Blick aus der Vogelperspektive.
Existence ist so ein bisschen ein Best-of-Album von Brin. Es tauchen nicht nur Themen aus vorherigen Büchern wieder auf, sondern sogar Textfragmente. Darin, aber auch in einigen konzeptionellen Fragen, ähnelt der Roman Kim Stanley Robinsons zeitgleich erschienenem 2312. Wann Existence beginnt, wird ganz am Schluss erwähnt – etwa 2050, also „near future“. Der Roman selbst umfasst mehrere Jahrzehnte, schnippselweise dargeboten aus der Perspektive mehrerer Hauptfiguren, dazwischen werden Bücher, Blogs und Mails zitiert. Ein gängiger Erzählmodus der Science Fiction.
Die Geschichte handelt – ohne damit zu viel zu verraten – von der Erstbegnung der Menschheit mit außerirdischen Zivilisationen (Trailer). Dies geschieht allerdings auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise. Auch hier ist Brin (ähnlich wie die Space Opera von Charles Stross – der übrigens wie Robinson einen Cameo-Auftritt in dem Buch hat) harte Science Fiction: Der Weg zu den Sternen ist für biologisches Leben zu weit, das einzige, was die Lichtjahre überbrücken kann, sind Maschinen und Informationen.
Noch spannender – und deswegen sagt mir der erste Teil auch deutlich mehr zu als die zweite Hälfte des Buches – finde ich das Thema hinter der (durchaus packenden) Handlung – Existence ist auch eine quasi-philosophische Abhandlung über die Prekarität des Fortbestehens einer Zivilisation (vgl. Fermi-Paradox …). Brin erläutert dazu nicht nur lange Listen möglicher Untergangsformen, sondern geht vor allem – und da wird es politisch – auch auf eine Frage ein, die gut zu meiner zum Jahreswechsel gestellten Frage danach, ob es so weitergehen kann, passt.
Immer wieder pendelt das Buch hier zwischen zwei Polen: zum einen der Pol der radikalen – z.B. ökologisch begründeten – Infragestellung technischen Fortschritts, den Brin als Wunsch nach Langsamkeit und Statik darstellt, und zum anderen der Pol des Wissenschaftsoptimismus, der in seinen Extremen im Buch durchaus auch lächerlich gemacht wird (beispielsweise in der Charakterisierung einer ExtropianerInnen-Konferenz), aber dem Brin doch näher zu stehen scheint. Dennoch ist das Buch – trotz des grundsätzliche Plädoyers für Optimismus – keine Brandschrift für die reine Freiheit der Wissenschaft, sondern im philosophischen Subtext eher eine Erörterung der mit dem Weiterbestehen einer technologischen Zivilisation verbundenen Fragen.
Es geht also darum, wie eine Gesellschaft mit wissenschaftlichem Fortschritt umgeht und wer darüber entscheidet, was – wie schnell – möglich sein darf. Im „wer entscheidet“ schwingt das Thema Demokratie vs. Feudalismus der Superreichen mit, aber auch das, was Brin politisch unter dem Schlagwort der transparent society seit Jahren vertritt. Sein Roman ist, nebenbei bemerkt, auch ein großes Plädoyer für gesellschaftliche Diversität (ebenfalls ein Motiv, das sich durch sein Werk zieht) und für eine Abkopplung der Definition des Menschlichen von der Spezies homo sapiens sapiens.
Darf eine Gesellschaft science courts einrichten, um Wissenschaft zu kontrollieren? Darf ein Moratorium verlangt werden, um „zu Atem zu kommen“? Oder ist eine völlig falsche Darstellung, den Wunsch nach Nachhaltigkeit mit dem fortschrittsskeptischen Wunsch nach Stillstand gleichzusetzen? Gibt es es Technologien, die nicht erlaubbar sind (kleiner Spoiler: der neurowissenschaftliche Umgang mit Autismus spielt hier im Buch ebenso eine große Rolle wie – noch so ein Selbstbezug, der den Charakter des „best of“ ausmacht – die Frage danach, ob ein „Uplifting“ anderer Spezies, z.B. Delfine, ethisch legitim ist). Und was passiert, wenn jemand, der sich das leisten kann, das einfach tut?
All diese Fragen, die Brins Roman zwischen und neben der Handlung für mich aufwirft, sind gerade aus grüner Perspektive durchaus relevant: Wie konservativ darf eine Partei sein, die die Welt retten will?
