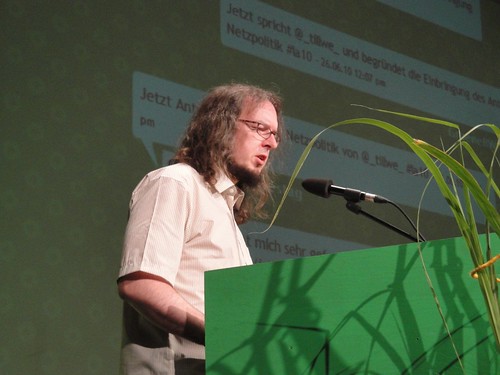Redemanuskript, Rede zur Antragseinbringung NP‑1 auf dem grünen Landesausschuss 26.06.2010
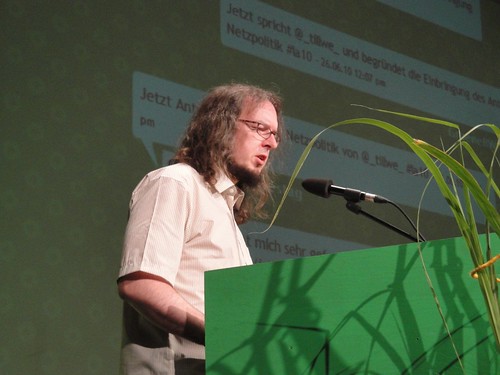
Liebe Freundinnen und Freunde,
„einsam, überwacht und arbeitslos“ – das waren die Befürchtungen, die im Orwell-Jahr 1984 aus grüner Sicht mit Datenschutz und Netzpolitik verbunden wurden. Im Mittelpunkt der Kritik stand das ISDN-Telefon. Unter „neuen Medien“ wurde Kabelfernsehen verstanden. Und die Idee, dass mit Bildschirmtext auch eine demokratische Utopie verbunden sein könnte, wurde vehement verneint. So war das 1984.
1994 gaben die ersten Browser dann den Startschuss für das Internet, wie es für die Mehrheit heute Alltag ist. Selbst jetzt sind sicherlich – obwohl das heute ja kein virtueller Parteitag ist – mindestens zehn Menschen online. Wenn der Innenminister meint, dass das Staunen über das Netz jetzt einmal ein Ende haben könne, dann hat er also nicht ganz unrecht.
Heute, im Jahr 2010, ist das Netz eine Infrastruktur, die aus Arbeitswelt, Freizeit, aus den Schulen und Universitäten – aber auch aus der Politik – längst nicht mehr wegzudenken ist. Dass wir heute überhaupt über Netzpolitik reden, fußt auf einem Beschluss der Landesdelegiertenkonferenz im letzten November. Der wiederum geschah in Reaktion auf die „Netzbewegung“ und Themen von der Vorratsdatenspeicherung bis zur Zensurinfrastruktur. Staunen ist vielleicht nicht notwendig – Bedarf für politische Einmischung gibt es jedoch zuhauf.
Der Antrag NP‑1 will aber mehr sein als nur ein Statement in dieser Auseinandersetzung. Klar: wir machen uns für Netzneutralität stark. Wir lehnen es ab, Datenschutz und Bürgerrechte auszuhebeln (egal, ob mit Hinweis auf die Sicherheitslage oder aus Profitinteresse). Wir wehren uns gegen Zensurversuche. All das kommt nicht zu kurz – keine Sorge!
Letztlich aber gilt: wenn wir Netzpolitik ernsthaft als grünes Thema diskutieren wollen, dann muss der Fokus weiter gefasst sein. Der Antrag NP‑1 nimmt diese Querschnittsperspektive ernst. Das bedeutet, Netzpolitik überall mitzudenken. Wer den Antrag durchblättert, findet viele Anregungen, wo das Netz für andere Politikfelder relevant wird. Drei Beispiele: Wenn es um ländliche Räume geht, geht es auch um Breitbandversorgung als Daseinsvorsorge. Beim Verbraucherschutz müssen wir Online-Geschäfte im Blick haben. Und wir dürfen e‑Petitionen und digitale Bürgerbegehren nicht vergessen, wenn Demokratie das Thema ist.
Eine Aneinanderreihung von Querschnitten ergibt allerdings noch keine kohärente Netzpolitik. Daher halten zwei „grüne Fäden“ unseren netzpolitischen Entwurf zusammen.
Der eine grüne Faden ist die Teilhabegerechtigkeit. Wie muss das Netz gestaltet und politisch reguliert sein, um zu einer gerechteren Teilhabe an Arbeit, Bildung und Demokratie in unserer Gesellschaft beizutragen? Mit dieser Frage wird schnell deutlich, dass wir über den „Zugang zum Zugang“ reden müssen. Es muss darum gehen, das Netz auch tatsächlich nützen zu können – also eine Frage der „Medienpädagogik“ (übrigens nicht nur für Kinder). Wir stellen fest: Die alte „Rundfunkmetapher“ greift nicht. Vielmehr haben wir es mit einem Kommunikationsraum zu tun haben, dessen aktive Nutzung wir begrüßen und fördern sollten – gerade dann, wenn es um politische Teilhabe geht. Aber zur Teilhabeperspektive gehört auch, dass es Menschen gibt, die nicht online sein wollen oder können. Gerade in einer Netzwerkgesellschaft muss der Staat dafür Sorge tragen, dass diese Gruppen nicht vergessen werden.
Der zweite grüne Faden ist die Informationswirtschaft. Was muss unternommen werden, damit in Baden-Württemberg der Strukturwandel zur Wissensgesellschaft in einer nachhaltigen Form gelingt? Ein wichtiges Element ist die Idee, Baden-Württemberg zum Spitzenstandort der „Green IT“ zu machen: das betrifft nicht nur die hier ansässigen Rechenzentrumsbetreiber, und die Frage, wie deren Klimabilanz aussieht – allen voran das staatliche Belwue-Netzwerk. Nein: Weitergedacht heißt diese Strategie, „Green IT“ zum durchgängigen Leitbild in Mittelstand, Industrie und Forschung machen – und so Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft im Land zu fördern. Zu einer umfassend zukunftsfähigen Informationswirtschaft gehört allerdings noch mehr. Dazu gehört die Qualifizierung von Fachkräften. Dazu gehört beispielsweise Open-Source-Software. Und dazu gehört nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit der Frage, was eigentlich „gute Arbeit“ in der Netzwerkgesellschaft ausmacht.
„Einsam, überwacht und arbeitslos“? Ich möchte dem heute, ein Vierteljahrhundert später, einen neuen Dreiklang grüner Netzpolitik gegenüberstellen. Denn wir haben inzwischen erfahren, dass das Netz soziale Zusammenhänge stärken kann. Wir sehen, dass Informations-dienstleistung Arbeit schafft, die weniger stark an Ressourcenverbrauch gekoppelt ist. Wir haben aber auch gelernt, dass es weiterhin notwendig ist, für Verbraucherschutz und Bürgerrechte im Netz zu kämpfen – erst recht dann, wenn die Infrastruktur in privater Hand liegt.
Auf den Punkt gebracht: „Sozial vernetzt, mündig nutzbar und klimafreundlich“ – dass sollte, meine ich, das Leitmotiv einer grünen Netzpolitik mit Gestaltungswillen sein!
Ich bitte euch um Zustimmung zu unserem Antrag und freue mich auf die Debatte!
Quelle: Kuhn, Fritz / Schmitt, Wolfgang (Hrsg.) (1984): Einsam, überwacht und arbeitslos. Technokraten verdaten unser Leben. Stuttgart: Die Grünen.
Foto: Grüne BaWü, Lizenz CC-BY-SA
Nachtrag: Hier geht’s zum Bericht der Partei über den TOP Netzpolitik
Nachtrag 2: Der Beschluss, der gegenüber dem Antrag in einigen Punkten ja noch modifiziert wurde, ist jetzt online (pdf).
 Seit kurzem habe ich mehr als 1000 Follower bei Twitter. Das freut mich natürlich, aber gleichzeitig sind das sind schon ganz schön viele potenzielle Tweet-LeserInnen.* Zum Vergleich: so ein grüner Bundesparteitag umfasst ungefähr so viele Menschen (inkl. Gäste und Presse), und die hören ungefähr genauso (wenig) aufmerksam zu wie die durchschnittlichen VerfolgerInnen bei Twitter. Und die richtig großen Uni-Hörsäle umfassen so 400 bis 800 Leute. Heißt das jetzt, dass jeder Tweet identisch mit einer Parteitagsrede, mit einer sehr großen Vorlesung ist? Bin ich ein Kanal?
Seit kurzem habe ich mehr als 1000 Follower bei Twitter. Das freut mich natürlich, aber gleichzeitig sind das sind schon ganz schön viele potenzielle Tweet-LeserInnen.* Zum Vergleich: so ein grüner Bundesparteitag umfasst ungefähr so viele Menschen (inkl. Gäste und Presse), und die hören ungefähr genauso (wenig) aufmerksam zu wie die durchschnittlichen VerfolgerInnen bei Twitter. Und die richtig großen Uni-Hörsäle umfassen so 400 bis 800 Leute. Heißt das jetzt, dass jeder Tweet identisch mit einer Parteitagsrede, mit einer sehr großen Vorlesung ist? Bin ich ein Kanal?