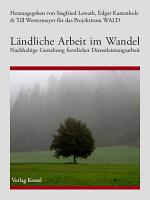 Wer schon immer mal wissen wollte, was bei meinem Forschungen zu forstlichen Dienstleistungsunternehmen (lang ist’s her) herausgekommen ist, hat jetzt die Chance, ein handliches Buch (knapp 300 Seiten) dazu zu lesen: Zusammen mit Prof. Dr. Siegfried Lewark und Dr. Edgar Kastenholz habe ich den Band Ländliche Arbeit im Wandel: Nachhaltige Gestaltung forstlicher Dienstleistungsarbeit herausgegeben, erschienen ganz frisch im Verlag Kessel.
Wer schon immer mal wissen wollte, was bei meinem Forschungen zu forstlichen Dienstleistungsunternehmen (lang ist’s her) herausgekommen ist, hat jetzt die Chance, ein handliches Buch (knapp 300 Seiten) dazu zu lesen: Zusammen mit Prof. Dr. Siegfried Lewark und Dr. Edgar Kastenholz habe ich den Band Ländliche Arbeit im Wandel: Nachhaltige Gestaltung forstlicher Dienstleistungsarbeit herausgegeben, erschienen ganz frisch im Verlag Kessel.
Kurz: Politik der Messinstrumente
Der Spiegel berichtet darüber, dass japanische Behörden nach dem Reaktorunfall in Fukushima das durchaus abschätzbare Ausmaß der radioaktiven Wolke bewusst verschwiegen haben. Ausführliches dazu lässt sich bei Nature nachlesen.
Was mir dazu einfällt, ist zunächst mal die Erinnerung an meine Verwunderung darüber, dass die über Twitter verbreiteten Ergebnisse des japanischen Ortsdosismessnetzwerks ausgerechnet für die Provinz Fukushima nicht angezeigt wurden. Das kann auch andere Gründe gehabt haben (Ausfall der Messsonden beispielsweise), würde aber in ein Bild des Desinformation passen. Zweitens fällt mir dazu ein, dass es eine ganze Zeit lang Streit darum gab, ob Daten aus dem empfindlichen globalen Überwachungsnetzwerk für Nukleartests ausgewertet werden dürfen, um den radioaktiven Fallout über dem Pazifik abzubilden. Und drittens und etwas genereller finde ich das ganze interessant, weil sich hier zeigt, wie Messinstrumente (und Computersimulationen) in politische Abläufe eingebunden werden, politisch nutzbar gemacht werden – oder eben, wenn die Messdaten nicht ins politische Konzept passen, ignoriert werden. Das hat was mit Open Data zu tun – aber auch mit der Frage, ob eine Regierung oder eine Behörde potenziell gefährliche Informationen – es hätte ja z.B. eine Panikreaktion geben können – verschweigen darf oder nicht. Gilt „information wants to be free“ auch – oder erst recht? – für das Management einer Katastrophe?
Ein Versuch über die Technikfeindlichkeit
Mein im November 2010 eingereichter Aufsatz „Technikfeindlichkeit. Ein Versuch über eine deutsche Debatte“* ist jetzt in der Revue d’Allemagne et des Pays de langue allemande** erschienen – in einer Ausgabe, die sich unter der Gastherausgeberschaft der Straßburger Professorin Florence Rudolf mit Umweltpolitik und Umweltsoziologie in Deutschland auseinandersetzt.
„Ein Versuch über die Technikfeindlichkeit“ weiterlesen
Kurz: Postindustrielle Forstwirtschaft
 Auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie im Jahr 2008 in Jena habe ich in der Sektion „Land- und Agrarsoziologie“ einen Vortrag über „Postindustrielle Forstwirtschaft und den Strukturwandel ländlicher Räume“ gehalten. Erschienen ist dieser im Jahr 2010 in der CD-ROM-Beilage zum Kongressband. Um den Vortrag etwas zugänglicher zu halten, möchte ich das Manuskript hier zur Verfügung stellen (in kleineren Punkten kann es Abweichungen von der CD-ROM-Fassung geben).
Auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie im Jahr 2008 in Jena habe ich in der Sektion „Land- und Agrarsoziologie“ einen Vortrag über „Postindustrielle Forstwirtschaft und den Strukturwandel ländlicher Räume“ gehalten. Erschienen ist dieser im Jahr 2010 in der CD-ROM-Beilage zum Kongressband. Um den Vortrag etwas zugänglicher zu halten, möchte ich das Manuskript hier zur Verfügung stellen (in kleineren Punkten kann es Abweichungen von der CD-ROM-Fassung geben).
Innerhalb der Land- und Agrarsoziologie, aber auch innerhalb der Politik für ländliche Räume wird vor allem der Landwirtschaft eine zentrale Rolle zuerkannt (Plieninger et al. 2006). Forstwirtschaft erscheint demgegenüber als sekundäres Phänomen. Diese Positionierung mag damit zusammenhängen, dass gerade auf der Seite der Forstwissenschaft ein spürbarer Anspruch, ‚alleine‘ für Forstwirtschaft und Waldräume zuständig zu sein, festzustellen ist. Eine regional orientierte Soziologie ländlicher Räume müsste die Wälder in den Blick nehmen. Dies gilt insbesondere, da Forstwirtschaft sich als Kontrastfolie zur Landwirtschaft eignet: Zwar werden zentrale Eigenschaften – Bodengebundenheit, Arbeit an der Natur, soziale Verankerung in ländlichen Milieus – geteilt, die sozioökonomische Struktur und die politische Einbettung unterscheidet sich jedoch deutlich. Im Folgenden möchte ich – nach einem kurzen Blick auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen – darauf eingehen, wieso die aktuelle Verfasstheit forstlicher Arbeit sinnvoll als ‚postindustrielle Forstwirtschaft‘ bezeichnet werden kann, um mit der Frage zu enden, ob postindustrielle Forstwirtschaft auch anders aussehen könnte. […]
Zitierweise: Westermayer, Till (2010): „Postindustrielle Forstwirtschaft und der Strukturwandel ländlicher Räume“, in Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.): Unsichere Zeiten. Herausforderungen gesellschaftlicher Transformationen. Verhandlungen des 34. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Jena 2008. Wiesbaden: VS, CD-ROM-Beilage 2010. Manuskript.
Nachdenken über Nachhaltigen Konsum
Vor ein paar Tagen habe ich ein bisschen was über die Münchener Tagung zu Konsum und Nachhaltigkeit geschrieben. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich für die Tagung Sustainable Consumption – Towards Action and Impact im November in Hamburg einen Abstract einreiche (die Deadline ist heute abend). Mir gefällt jedenfalls die Ausrichtung der Tagung, und einige der Keynote-Speaker klingen auch sehr spannend. Das mal als Vorbemerkung zu den folgenden Überlegungen zum Thema „Nachhaltiger Konsum“.
Ein Grundproblem der sozialwissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdebatte ist meiner Meinung nach die doppelte Bedeutung des Begriffs „nachhaltig“. Und damit meine ich jetzt nicht die Tatsache, dass das Adjektiv auch als Synonym für „dauerhaft“ verwendet werden kann, sondern die Unterscheidung zwischen einer materiellen und einer symbolischen Ebene, wenn es um „nachhaltigen Konsum“ oder um „nachhaltige Lebensstile“ geht. Das sieht dann ungefähr so aus:
„Nachdenken über Nachhaltigen Konsum“ weiterlesen


