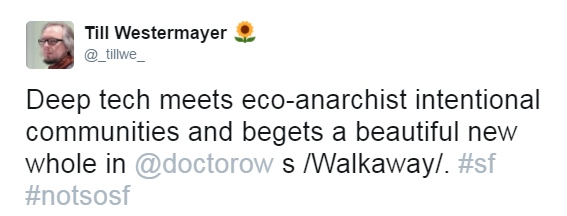Im Mai bin ich gar nicht so zum Lesen gekommen, wie ich das eigentlich wollte. Das lag unter anderem an den Wahlen (die ich dann lieber verfolgt habe, statt ein Buch zu lesen), aber auch an diversen Filmen, die ich alleine oder mit meinen Kindern angeschaut habe. Neben diversen Ausgaben des MERKUR (den ich im Allgemeinen sehr mag, der aber oft ungelesen liegenbleibt) und dem Kinderbuch Das Augen-Verwirr-Buch von Silke Vry (optische Täuschungen in Kunstwerken; schön gemacht, aber meine Kinder fanden es eher langweilig) waren das vor allem zwei Bücher:
Jorge Cham und Daniel Whiteson haben We have no idea – A guide to the unknown universe veröffentlicht. Ja, richtig, ein Sachbuch. Cham ist vor allem für die PhD-Comicserie bekannt, Whiteson ist ein kalifornischer Experimentalphysiker. We have no idea ist flott geschrieben – und handelt tatsächlich genau davon: Was wir alles nicht wissen über das Universum. Nebenbei wird dann erklärt, was wir alles wissen, wie weit weg andere Sterne tatsächlich sind, und wie das mit dem Urknall und dem ganzen Zeugs so gelaufen ist. Was wir nicht wissen? Wie groß das Universum ist, ob es in etwas anderes eingebettet ist, woraus Quarks bestehen (und ob es eine Art Periodensystem der Bosonen/Leptonen gibt, das auf zugrunde liegende Muster schließen lässt), ob das Universum in seiner kleinsten Abmessung „digital“ (also diskret) oder „analog“ organisiert ist, wie Quantenmechanik und Gravitation zusammenpassen, was Masse ist, naja, und noch so einiges mehr. Trotz einiger Wiederholungen sehr interessant. Zumindest fühle ich mich jetzt schlauer.
Das andere Buch, das ich im Mai gelesen habe, ist Cory Doctorows neuer Roman Walkaway. Doctorow ist ein sehr politischer Science-Fiction-Autor, und manche seiner früheren Bücher lesen sich eher wie in Belletristik gegossene politische Manifeste. Bekannt geworden ist er vor allem für sein Eintreten für offene Software und offene Daten, gegen proprietäre Systeme und gegen Überwachung. Walkaway hat auch Stellen, die eher Manifestcharakter haben. Es ist aber doch mehr. In einen Tweet gepackt, hatte ich dazu geschrieben:
Doctorow selbst nannte das eine sehr gute Zusammenfassung. Auseinandergenommen, geht es um folgendes. Die Zukunft, die Doctorow skizziert, ist eine, in der „deep tech“ allgegenwärtig ist – also künstliche Intelligenz, 3D-Drucker, Internet of Things und autonome Maschinen und all sowas. Im Mainstream-Teil der von ihm beschriebenen Gesellschaft ist aus dem Kapitalismus, wie wir ihn kennen, ein Überwachungsregime geworden, das auf „deep tech“ aufbaut – und in dem einige wenige „Zottas“ das Sagen haben. Zottas sind die immens reiche Eigentümerfamilien der Konzerne. Ich nehme an, dass Doctorow dabei einen obskuren Präfix für sehr große Zahlen vor Augen hatte (Zetta- ist der SI-Präfix für 10^21, Zotta- soll ein SI-Präfix für 10^255 sein). Jedenfalls: sehr, sehr reiche Ultrareiche, die eigentlichen Herrscherinnen und Herrscher über die Mainstream-Welt (die Doctorow als „Default“ bezeichnet).
Dass es einige dort nicht aushalten, verwundert nicht. In der von Doctorow beschriebenen Zukunft sind es die Walkaways, die quasi-nomadisch in verwüstete Gebiete ziehen, dort mit Hilfe von Fabbern, 3D-Druckern und als Open Source zugänglichen Bauplänen (oder gecrackten proprietären Plänen) etwa für Flüchtlingsunterkünfte Häuser bauen und als „eco-anarchist intentional community“, also als anarchistische Kommune dort leben. Ohne Geld, ohne Besitz – im Zweifel wird halt schnell mal der 3D-Drucker angeworfen -, eher gewaltfrei, gerne polyamorös und mit eigenen Solarzellen und Windrädern auch ein bisschen ökologisch.
Der Spannungsbogen des umfangreichen Buchs hängt nun unter anderem am Zusammentreffen dieser beiden Welten. Die Hauptfigur nennt sich Iceweasel, ist Tochter eines Zotta-Clans und läuft mit einigen Freunden davon in die Welt der Walkaways.
Das geht lange gut (und wird von Doctorow auch in schöner utopischer Ausführlichkeit geschildert), aber irgendwann schlägt „Default“ zurück – mit Drohnen und schwerem Kriegsgerät. Randbedingung #1: das aufgegebene Land ist ökologisch ziemlich kaputt. Randbedingung #2: die im freien Zusammenschluss vor sich hin werkelnden Wissenschaftler*innen der Walkaway University stehen kurz davor, Gehirne zu Software zu machen. Ende der Utopie? Oder erst der Anfang?
Mehr zu verraten, scheint mir an dieser Stelle nicht angebracht zu sein. Wer aus einer der beiden Szenen – alternative Lebensstile oder Hacker-Maker – kommt, wird sich jedenfalls in Walkaway wiederfinden, und vielleicht auch ein bisschen Selbsterkenntnis mitnehmen.
Walkaway ist am Schluss eine Utopie. Und als solche alles andere als eine Blaupause für die bessere Welt. Die eine oder andere Anregung dafür, was „deep tech“ in einem anderen Denkkontext noch könnte, und welche Potenziale Open Source Hardware haben könnte – im Rahmen von Degrowth wird darüber heute schon sehr ernsthaft diskutiert -, lassen sich dort allerdings doch finden. Nicht nur deswegen hat’s mir sehr gut gefallen.