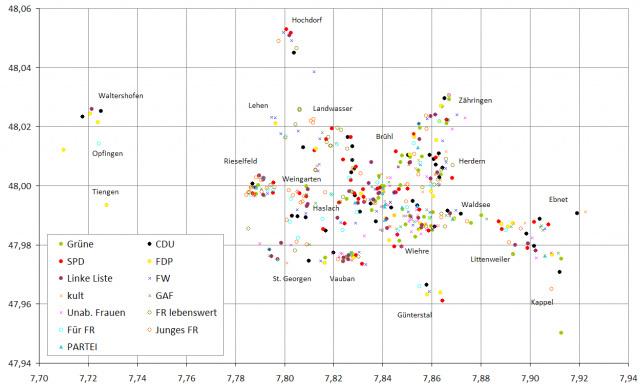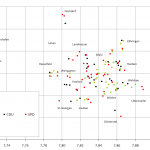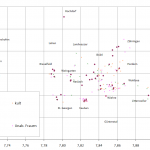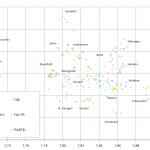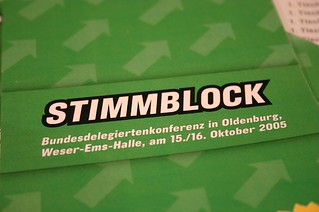 Die einen geben Interviews, die in Überschriften münden, in denen massive Kurskorrekturen gefordert werden. Die anderen veröffentlichen ein Manifest nach dem anderen, und rufen nach dem Neuanfang, dem Reload, der Wiedergeburt und was es da noch so alles an Synonymen gibt. Kurzum: So chaotisch und unfokussiert wie seit der verlorenen Bundestagswahl habe ich meine Partei noch nicht erlebt. Die Zeit des Burgfriedens scheint vorbei zu sein, Flügelkämpfe branden wieder auf, und quer dazu wird über Fragen wie „Umwelt als Kern“ oder „breit aufgestellte linksliberale Partei“ diskutiert.
Die einen geben Interviews, die in Überschriften münden, in denen massive Kurskorrekturen gefordert werden. Die anderen veröffentlichen ein Manifest nach dem anderen, und rufen nach dem Neuanfang, dem Reload, der Wiedergeburt und was es da noch so alles an Synonymen gibt. Kurzum: So chaotisch und unfokussiert wie seit der verlorenen Bundestagswahl habe ich meine Partei noch nicht erlebt. Die Zeit des Burgfriedens scheint vorbei zu sein, Flügelkämpfe branden wieder auf, und quer dazu wird über Fragen wie „Umwelt als Kern“ oder „breit aufgestellte linksliberale Partei“ diskutiert.
Da ich nicht möchte, dass Bündnis 90/Die Grünen nach einer bis dahin durchaus erfolgreichen Geschichte mit 35 oder so in die Midlife-Crisis geraten, glaube ich, dass wir uns sowohl die Piraten als auch die FDP als mahnendes Beispiel vornehmen sollten. Die Piratenpartei hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, vom Hoffnungsträger im Parteienspektrum zur Metapher für „intern zerstrittene, nach außen unsympathisch auftretende Partei“ zu werden. Und die FDP – was lässt sich von der FDP lernen? Irgendwo zwischen 18-Prozent-Spaßwahlkampf und Regierungsbeteiligung um jeden Preis hat sie ihr politisches Profil verloren.
Insofern: Ja, wir sollten nach vorne schauen und durchaus abklären, ob grüne Rezepte noch den inhaltlichen Herausforderungen von morgen entsprechen. Wir sollten das in hoher Qualität sowohl der Meinungsäußerungen wie des Streitniveaus tun. Uns selbst komplett in Frage stellen, oder die günstige Gelegenheit für die 180°-Wende zu nutzen, halte ich dagegen nicht für produktiv; genauso wie die Reduzierung von Politik auf Koalitionsoptionen. 2016 in Baden-Württemberg und 2017 im Bund wird es – meine ich – darum gehen, als die Partei aufzutreten, die gute Ideen und gutes Personal hat, die sich nicht scheut, die großen Probleme anzusprechen, die ihren eigenen Lösungvorschlägen vertraut (statt sich auf Formelkompromisse zu reduzieren, die dann von jeder beliebigen Seite aus in Frage gestellt werden), die bei aller Sympathie nicht auf gefällige Beliebigkeit setzt, und die Zerstrittenheit und Grabenkampf anderen überlässt. Kriegen wir das hin?