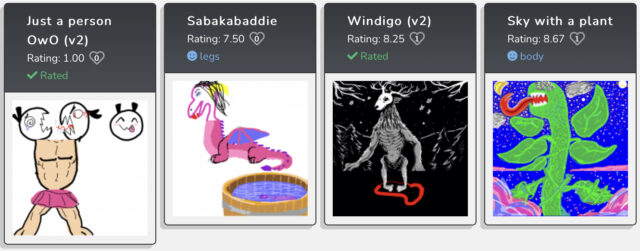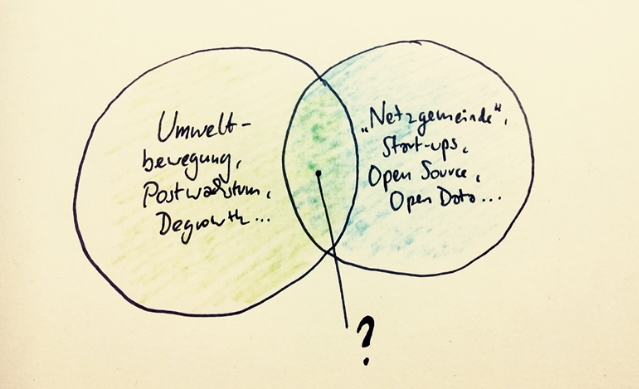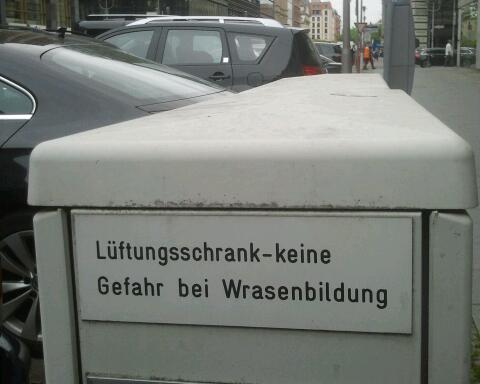Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, nichts dazu zu sagen, dass Twitter nach einigen Betatests etc. jetzt tatsächlich für Website (und wohl auch Apps) aus dem „Fav“-Sternchen ein „Fav“-Herzchen gemacht hat. Aber weil’s so hübsch animiert ist, wenn ich auf der Website das Herz anklicke, doch ein paar Worte dazu.
Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, nichts dazu zu sagen, dass Twitter nach einigen Betatests etc. jetzt tatsächlich für Website (und wohl auch Apps) aus dem „Fav“-Sternchen ein „Fav“-Herzchen gemacht hat. Aber weil’s so hübsch animiert ist, wenn ich auf der Website das Herz anklicke, doch ein paar Worte dazu.
Ich weiß nicht, wie es euch geht – ich ertappte mich manchmal dabei, beim Klicken auf das (bisherige) Sternchen, ein „drücke die Daumen“ oder „finde ich auch, genau meine Meinung“ oder „ok, Argument passt, Diskussion zu Ende“ zu subvokalisieren. Soll heißen: je nach Kontext – mit wem habe ich es zu tun, was ist der bisherige Debattenverlauf, um was für ein Thema geht es – habe ich das Sternchen unterschiedlich verwendet. Das Spektrum reicht dabei von inhaltlicher Zustimmung über emotionale Unterstützung bis hin zu einem Marker für Interesse oder dafür, dass ich etwas gelesen habe, und jetzt nicht noch einmal darauf eingehen muss, sondern finde, dass die Debatte jetzt zu Ende sein darf. Das alles nur das, was ich mir so beim Klicken dachte – wie diejenigen, die „gefavt“ wurden, das interpretiert haben, weiß ich nicht. Und zumindest dem Hörensagen soll das Sternchen bei anderen durchaus auch nur „muss ich noch mal anschauen, Bookmark gesetzt“ heißen (das wäre die Semantik, in der Chrome Sternchen verwendet – anders als die Sternchen bei Amazon, die ja „gefällt mir“ ausdrücken). Ein „Fav“ kann also ganz unterschiedliches bedeuten und ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Damit ist es (oder war es) flexibler als „gefällt mir“ von Facebook.
Jetzt also Herzen. Die sind viel mehr als Sternchen mit Bedeutung aufgeladen. Für einen Teil der oben skizzierten Nutzenspraktiken passt auch ein Herz – alles von „ich mag dich“ bis „ich mag das“ bis „fühl dich gedrückt“. Für „gutes Argument“ oder „sehe ich auch so“ oder „hmm, interessanter Hinweis“ – eher weniger. Und das fiel mir auf, als ich gerade die „Nature“ dafür herzte, dass sie darüber berichtete, dass der neue kanadische Premierminister einen Posten „Wissenschaft“ im Kabinett vorsieht. War lustig animiert, der Druck aufs Herzchen – aber eigentlich gar nicht so emotional aufgeladen, wie es aussah. Insofern: Spannend wird jetzt sein, wie wir Twitter-NutzerInnen mit den Herzen umgehen werden. Die Funktionalität ist die gleiche, die Semantik ist fluide – auch ein Herz kann eine Brezel ein Sternchen sein. Wenn alle das so lesen und sehen. Oder es kommt zu Boykotten, Protestaktionen usw. – das Drohpotenzial gegenüber der Firma Twitter ist allerdings verdammt niedrig. Ich tippe drauf, dass das Herz bleibt, und Twitter – das Medium – sich dadurch letztlich nicht wesentlich ändert. Anders wäre es bei Maßnahmen wie einer nicht mehr chronologischen oder gar gefilterten Timeline. Das würde den ganz besonderen Charakter Twitters maßgeblich verändern. Und nicht zum Besseren.