Die Schulz-Story von Markus Feldenkirchen – ich habe den Fehler gemacht, sie als Hörbuch zu kaufen und gemerkt, dass das einfach nicht mein präferierter Wahrnehmungskanal ist, aber das ist eine andere Geschichte – also: die Schulz-Story ist ein beeindruckendes Stück Journalismus, bis hin zu den wie nebenbei in den Text eingestreuten Erläuterungen zu Fachbegriffen und politischen Situationen. Sie lässt sich auf drei Ebenen lesen: als Text über die Person Martin Schulz, als Text über den Zustand der SPD, und als Text über einige Dysfunktionalitäten unseres politischen Systems.
Nach der Wahl ist nach der Wahl
Die Hoffnung, dass der zweite Wahlgang alles noch einmal drehen könnte, zerschlug sich ziemlich schnell – mit den ersten paar ausgezählten Wahlbezirken war klar, dass Martin Horn noch einmal deutlich zugelegt hat und zum neuen Oberbürgermeister von Freiburg gewählt worden ist. Dieter Salomon und Monika Stein blieben jeweils mit leichten Verlusten auf dem Ergebnis des ersten Wahlgangs. Dass es schwierig sein könnte, ein Plus an Stimmen zu erreichen, hatte ich erwartet – dass fast exakt die Stimmenzahl aus dem ersten Wahlgang für Dieter Salomon übrig blieb, wundert mich doch etwas, da ich von vielen Stein-Wähler*innen gehört habe, dass sie ihre Stimme diesmal an Salomon geben wollten. Hinter den scheinbar gleichbleibenden Stimmenzahlen dürfte also eine gewisse Dynamik aus Wählerwanderung und Mobilisierungseffekten stecken. Unterm Strich zählt jedoch die Stimmenzahl, und die ist – leider – eindeutig.
| Wahl- berech- tigte | Wähler* innen | Stein, Monika | Kröber, Manfred | Horn, Martin | Dr. Salomon, Dieter | Behringer, Anton | Wermter, Stephan | Sonstige | |
| 1. | 170.793 | 87.118 51,0% |
22.726 26,2% |
1.240 1,4% |
30.066 34,7% |
27.095 31,3% |
3.244 3,7% |
2.252 2,6% |
70 0,1% |
| 2. | 170.419 | 88.190 51,7% |
21.235 24,1% |
– | 38.899 44,2% |
27.009 30,7% |
796 0,9% |
– | 47 0,1% |
Mich ärgern zwei Mythen, die jetzt über diese Wahl erzählt werden. Der eine Mythos ist der von der grünen Spaltung in Freiburg. Monika Stein sitzt für die GAF – Grüne Alternative Freiburg – im Gemeinderat. Das ist eine Abspaltung der Grünen, diese Spaltung ist allerdings schon etwa zehn Jahre her. Zudem trat Monika als Kandidatin eines linken Bündnisses an, bestehend aus der Linkspartei-nahen Linken Liste, den Unabhängigen Frauen, Junges Freiburg und PARTEI sowie diversen Einzelunterstützer*innen. Der Aufruf aus der Ferne, dass Grüne und Grüne zusammenhalten müssten, dass so eine Spaltung doch blöd sei, oder dass es verwundere, dass seitens von Monika kein Wahlaufruf für Dieter erfolgte, verkennt die lokale Situation. Beileibe nicht alle Wähler*innen von Monika „ticken“ grün, und auch inhaltlich gibt es klare Unterschiede zwischen ihrem Programm und dem der Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bzw. dem des noch amtierenden Oberbürgermeisters.
Das zweite ist die Geschichte davon, dass damit das Ende der grünen Ära in Baden-Württemberg hereinbrechen würde. Ich möchte hier daran erinnern, dass Horst Frank, grüner OB von Konstanz, von 1996 bis 2012 regierte und danach ein CDU-Bürgermeister gewählt wurde. Insofern ist es zwar ärgerlich, aber keine „Sensation“ (O‑Ton SPD), dass ein amtierender grüner Oberbürgermeister nach 16 Jahren abgewählt wird. Natürlich ist es mit den aktuellen Streits in der Koalition im Landtag und der klaren grün-schwarzen Unterstützung in Freiburg eine schöne Geschichte, diese Abwahl zu einem landespolitischen Menetekel zu machen, gar von einem Erdbeben zu sprechen – das alles trifft es nicht. Die Erde hat vor ein paar Tagen in Müllheim bei Freiburg gebebt; die Oberbürgermeisterwahl wurde dagegen nicht landes‑, sondern stadtpolitisch oder vielleicht sogar personenspezifisch entschieden.
Jetzt schon lassen sich aus meiner Sicht drei Lehren aus dieser Wahl ziehen.
Erstens: den Oberbürgermeister zu stellen und im Gemeinderat stark vertreten zu sein, ist kein Selbstläufer und heißt nicht, dass Erfolge automatisch honoriert werden. Mancherseits gab es den Eindruck, dass da nichts Neues mehr kommt, dass zwar viel für Freiburg erreicht wurde, aber die Visionen für die nächsten acht Jahre fehlten. Das hat eine inhaltliche Komponente – wer grün wählt, will auch klare grüne Erfolge sehen; zumindest gilt dies für einen relevanten Anteil der grünen Wählerschaft. Das Kommunale ist sehr konkret; noch stärker als auf Landes- und Bundesebene zählt hier das sichtbare Ergebnis politischen Handels, wie es im Alltag ankommt oder nicht ankommt. Einmal errungene Erfolge werden dabei schnell vergessen und als selbstverständlich angesehen. Nur gut zu verwalten reicht nicht aus. Oder, etwas zugespitzer gesagt: so wichtig eine Erweiterung des grünen Wählerklientels in die Breite der Bevölkerung ist – der grüne Kern und dessen Interessen sollten nicht vergessen werden. Sonst wird, wie im Vauban und in den Innenstadtgebieten von Freiburg, im Zweifel auch mal links(grün) gewählt.
Neben der inhaltlichen geht es hier aber auch um eine kommunikative Komponente. In diese Lücke hat Martin Horn sehr genau gezielt, in dem das Bild eines arroganten Oberbürgermeisters in Umlauf gegeben wurde, dem Bürgerbeteiligung und bürgernahe Kommunikation entgegengestellt wurde. Kommunikativ auch jenseits der Verbände und Bürgervereine präsent zu sein, die erreichten Erfolge immer wieder auch „zu verkaufen“, und neue Visionen mit Bürger*innen zusammen zu erarbeiten – das ist sicherlich ein Problem, das weit vor dem Wahltermin vorhanden war und sich jetzt vollends ausgewirkt hat. (Über die Kampagne, insbesondere zum ersten Wahlgang, schreibe ich jetzt lieber nichts).
Zweitens: Die Stadt stand und steht gut da der Oberbürgermeister war erfolgreich. Also wurden mögliche, noch dazu stadtfremde, Gegenkandidaten lange Zeit nicht besonders ernst genommen. Dass ein amerikanisierter Wahlkampf mit viel Präsenz (der der Suggestion von Präsenz), viel Händeschütteln und Sorgen anhören, mit einem populistisch angehauchten Auftreten ohne viel Inhalte, aber mit einprägsamen Slogans auch in Freiburg zünden könnte, wurde nicht gesehen – und als es gesehen wurde, war es zu spät. Da hatte Martin Horn längst überall in der Stadt ein Samenkorn des Kümmerns eingesät, jedem alles versprochen – auf die Umsetzung bin ich gespannt – und den Wahlkampf in die Hände eines umtriebigen Graswurzelnetzwerks gelegt, das mit vielfältigen Aktionen Sichtbarkeit in der Stadt erzeugte und weit über den Parteiapparat der SPD wirkte. Im zweiten Wahlgang kam dazu dann noch der Bandwaggon-Effekt dazu, also ein Aufspringen auf den siegreichen Zug.
Ich nehme an, dass mit einem solchen – charismatischen – Wahlkampf in Zukunft stärker zu rechnen sein wird. Was das für Politik bedeutet, wäre zu diskutieren.
Drittens: Sechzehn Jahre sind eine ganz schön lange Zeit, egal, wer Oberbürgermeister oder Kanzlerin ist. Demokratie lebt vom Wechsel. Vielleicht muss darüber nachgedacht werden, ob die bisherige, in Baden-Württemberg acht Jahre währende Bürgermeisterwahlperiode nicht zu lang ist. (Ober-)Bürgermeister*in zu sein, ist kein Lebenszeitjob mehr, sondern wird stärker als früher zum politischen Amt auf Zeit. Hier könnte ich mir vorstellen, dass eine Verkürzung der Wahlperiode auf fünf Jahre angemessener wäre. Und auch der zweite Wahlgang, der ja in Baden-Württemberg keine Stichwahl darstellt, sondern eine eigenständige Wahl, bei der dann die relative Mehrheit reicht, sollte noch einmal genauer betrachtet werden. Ist es sinnvoll, wenn ein Oberbürgermeister von der Mehrheit der Stadtbevölkerung nicht gewählt wird? Wäre es nicht besser, wenn der zweite Wahlgang als echte Stichwahl ausgestaltet wäre?
Zusammengefasst: Das Wahlsystem hat einige Eigenheiten, die durchaus auf den Prüfstand gestellt werden könnten. Wahlkampf wird amerikanischer und persönlicher, eine Mobilisierung schon weit im Vorfeld der Wahl gewinnt an Bedeutung. Erfolgreiches politisches Handeln muss auch kommuniziert und diskutiert werden, und zwar nicht erst bei der Wahl, sondern kontinuierlich. Und: sich auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen, reicht nicht aus.
Ich habe ja geschrieben, dass ich die Einschätzung für falsch halte, dass die Wahl in Freiburg eine landespolitische Wahl war. Richtig ist allerdings, dass wir uns – gerade in der grün-schwarzen Koalition – verstärkt überlegen sollten, wie es um Angebote an den grünen Kern unserer Wählerschaft bestellt ist, und wie es gelingt, Erfolge auch sichtbar zu machen.
re:publica, oder: das Gute im Netz
Die junge Fernsehschaffende Sophie Passmann liefert den passenden Einstieg für meinen Bericht über die re:publica 2018.
Mein Fazit zur #rp18: Digitalisierung: wichtiges Thema, sollten wir mal ran.
 Und spricht damit, ganz unironisch, die größte Schwäche und die größte Stärke der wie immer viel zu vollen (so ungefähr 20.000 Besucher*innen, 500 Panels, 50.000 Tweets und 30.000 Bälle im Bällebad, unzählige Seifenblasen) Veranstaltung an. Die re:publica ist nach wie vor eine Netzpolitik-Konferenz, keine Digitialisierungskonferenz.
Und spricht damit, ganz unironisch, die größte Schwäche und die größte Stärke der wie immer viel zu vollen (so ungefähr 20.000 Besucher*innen, 500 Panels, 50.000 Tweets und 30.000 Bälle im Bällebad, unzählige Seifenblasen) Veranstaltung an. Die re:publica ist nach wie vor eine Netzpolitik-Konferenz, keine Digitialisierungskonferenz.
Also, vielleicht ist das. Vielleicht habe ich auch wieder mal nur die falschen Panels erwischt/ausgesucht.
Am zweiten re:publica-Tag war dieser Unterschied zwischen Digitalisierung und Netzpolitik für mich eher so ein vages Gefühl. Auch, weil sich ganz viel gar nicht so anders anfühlte und anhörte, als bei meinem letzten re:publica-Besuch. Und der ist schon fünf Jahre her.
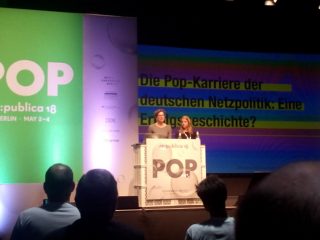 Heute hörte ich dann einen Vortrag von Jeanette Hofmann, Urgestein der Netzforschung in Deutschland, und Ronja Kniep, beide vom Wissenschaftszentrum Berlin, der ganz gut zu diesem vagen Gefühl passte und das ordentlich akademisch kontextualisierte. Die beiden gingen der Frage nach, ob Netzpolitik in Deutschland ein ordentliches Politikfeld ist. Dafür braucht es, so der theoretische Hintergrund, insbesondere ein gesellschaftlich akzeptiertes Schutzgut. Also sowas wie „Netzfreiheit“.
Heute hörte ich dann einen Vortrag von Jeanette Hofmann, Urgestein der Netzforschung in Deutschland, und Ronja Kniep, beide vom Wissenschaftszentrum Berlin, der ganz gut zu diesem vagen Gefühl passte und das ordentlich akademisch kontextualisierte. Die beiden gingen der Frage nach, ob Netzpolitik in Deutschland ein ordentliches Politikfeld ist. Dafür braucht es, so der theoretische Hintergrund, insbesondere ein gesellschaftlich akzeptiertes Schutzgut. Also sowas wie „Netzfreiheit“.
Kurzer historischer Abriß: In den 1980ern gab’s, netzpolitisch gesehen, auf der einen Seite das staatliche Bundespostmonopol, auf der anderen Seite eine Computersubkultur (Hacker, CCC, Foebud, FifF etc.), und ein paar akademische Fans der neuen Technik (erste E‑Mail in Deutschland an der Uni Karlsruhe). Nischen und Infrastrukturpolitik also.
In den 1990er Jahren geht’s auf der Datenautobahn in die Informationsgesellschaft. Der Telekommunikationsmarkt wird liberalisiert, und überhaupt dominieren wirtschaftliche Sichten auf das Netz, das jetzt als Arena für verschiedene Dienstleistungen diskutiert wird.
Mit den 2000er Jahren tritt erstmal die Netzpolitik als eigenständiger Politikbereich ins Licht der Öffentlichkeit. Beckedahl und Notz, Freiheit-statt-Angst-Demos, eine Zensursula-Bewegung, der Aufstieg (und Fall) der Piratenpartei. Auch die 1980er-Subkultur-Initiativen tauchen, teils in gewandelter Form, wieder auf. Datenschutz kommt dazu. Insgesamt wird die Idee, dass ein freies und offenes Netz etwas schützenswertes sein könnte, also ein Schutzgut, zum gesellschaftlich akzeptierten Deutungsmuster. Die Netzpolitik, wie wir sie kennen, ist geboren. Und gebloggt wird auch darüber.
Die 2010er Jahre sind dann in dieser kurzen Geschichte der Pendelschlag zurück. Klar, die Datenschutzgrundverordnung und der Cambridge-Analytica-Skandal sind in aller Munde, aber noch wichtiger sind „Digitalisierung“ – vor allem wirtschaftlich gedacht – und „Cybercrime“ bzw. „Cybersecurity“, also sicherheitspolitische Überlegungen. Netzpolitik als eigenes Politikfeld verliert an diskursiver Deutungsmacht – und damit verändert sich auch der politische Möglichkeitsraum. (Und das, so Hofmann, ist ein deutlich größeres Problem als die Frage Digitalisierungsministerium ja/nein).
Soweit der holzschnittartige Abriß des schon auf nur dreißig Minuten gekürzten Vortrags von Hofmann und Kniep über ihre Forschungsarbeit. Eine Session von ein paar hundert, voll, aber nicht auf der ganz großen Bühne.
Und irgendwie trifft diese Unterscheidung eben ganz gut auf meine Wahrnehmung der diesjährigen re:publica zu. Disclaimer: das mag an meiner Auswahl an Veranstaltungen gelegen haben – vielen Medienpolitik und Medienmacher*innen, ein bisschen Konzept- und Aktionskunst, einiges zu Open Culture und auch ein bisschen was zu Datenschutz. Vielleicht würde mein Bild ganz anders aussehen, wenn ich mir mehr der „Partnersessions“ der Werbepartner angeschaut hätte (ein Vortrag einer Autodesk-Frau zu den Potenzialen von Robotern und KI für den Bau einer besseren Welt ging in diese Richtung), oder die Tracks zu Arbeit oder Gesundheit.
In meiner Panel-Auswahl, und auch in einigen Gesprächen, war es aber so, dass in den Panels viel über Netzpolitik geredet wurde – alles mögliche, was mit dem medialen Kommunikationsraum Netz, den dort bewegten Daten und ihrem Schutz sowie mit der darunterliegenden Soziotechnik zu tun hatte – und kaum über Digitalisierung. (Und um den Umgang mit rechtem Hass im Netz, vielleicht war dass das eigentliche große Thema). Jedenfalls: um das freie und offene Netz, um die „Zurückeroberung“ des Internets.
Ganz anders das Bild, das sich auf dem Gelände bot: schon am Eingang begrüßte der Postbot*innen hinter her fahrende Postbot, eine schnuckelige Art Getränkebox auf Rädern. An mindestens jedem zweiten Stand hingen VR-Brillen. Und zwischen Bitcoin-Startups und Tech for Good, neuer Arbeitswelt und Google-AIs ging es an den Ständen um Digitalisierung, wie das halt heute so gemacht wurde.
Vielleicht wäre Sepia als Leitfarbe besser gewesen als das poppige Grün der Green Screens. Nostalgie für den utopischen Kommunikationsraum, um den „wir“ in den 2000er Jahren gekämpft haben. Vertrautheit mit dem Tagungsort, der STATION Berlin. Selbst das WLAN erkannte einen wieder. Oder doch Begeisterung darüber, wie normal das alles inzwischen ist?
Warum blogge ich das? Hey, ein re:publica-Besuch ohne Blogpost dazu wäre ja irgendwie schräg.
Wissenschaft in der wirklichen Welt

Zwischen OB-Wahlkampf in Freiburg und dem Besuch der re:publica in Berlin will ich doch noch die Gelegenheit nutzen, ein paar Eindrücke vom Reallabor-Symposium zusammenzufassen, das letzten Freitag in Karlsruhe stattfand.
Reallabore sind zumindest in bestimmten wissenschaftspolitischen Feldern und in der Nachhaltigkeitsforschung ein fester Begriff. Aufbauend auf Lehr-Lern-Projekten etwa an der ETH Zürich fand das Konzept „Reallabor“ Eingang in die Empfehlungen der von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer eingesetzten Expertenkommission „Wissenschaft für Nachhaltigkeit“ – und wurde dann auch prompt umgesetzt. Wenn ich mein Verständnis von Reallaboren (oder, im internationalen Diskurs: „real world laboratories“) zusammenfasse, dann geht es dabei um Forschungsprojekte, in denen konkrete (zumeist lokalisierbare) Probleme gelöst werden, indem Wissenschaft und Praxis – idealerweise auf Augenhöhe – diese zusammen definieren (Ko-Design), Lösungsansätze erproben (Realexperimente) und daraus entstehendes Wissen wieder in den wissenschaftlichen Diskurs einspeisen.
Photo of the week: Election campaign IX
In gut einer Woche steht der zweite Wahlgang für die Oberbürgermeisterwahl in Freiburg an. Ich hoffe, dass viele es so wie ich sehen, und Martin „der Prediger“ Horn nicht für den geeigneten Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters halten. Der Wahlkampf zieht jedenfalls gerade mächtig an. Heute hatte Dieter Salomon Besuch von Cem Özdemir, beide hielten vor dem Theater inmitten einer grünen Landschaft kurze Reden und stellten sich dann den Fragen der Bürgerinnen und Bürger.
Dabei wurde deutlich, dass Dieter wählen eben nicht einfach „weiter so“ heißt. Hinter „Freiburg muss grün bleiben“, „Freiburg muss bunt bleiben“, „Freiburg muss sozial bleiben“, „Freiburg muss jung bleiben“ und „Freiburg muss erfolgreich bleiben“ – den fünf zentralen Botschaften der Kampagne für den zweiten Wahlgang steht beides: der Erfolg der bisherigen zwei Amtsperioden des Oberbürgermeisters, die Freiburg zu einer grünen, vielfältigen, solidarischen und durchaus auch wirtschaftlich erfolgreichen Stadt gemacht haben, und der Blick auf die Herausforderungen, die jetzt kommen: die Klimaziele werden nicht von alleine erreicht. Um Wohnungen zu schaffen und eine weiterhin soziale und vielfältige Stadt zu erhalten, reichen schöne Worte nicht aus, vielmehr geht es jetzt darum, Dietenbach zu einem weiteren typisch Freiburger Stadtteil zu machen. Wenn ich höre, wie in anderen Städten über fehlende Kitaplätze und schlechte Schulen geklagt wird, glaube ich, dass Freiburg hier eine sehr erfolgreiche Politik gemacht hat und weiter machen wird – unter anderem mit dem Neubau für die Staudinger-Gesamtschule. Und gerade in den letzten Jahren ist – „Freiburg muss erfolgreich bleiben“ – sichtbar geworden, dass Freiburg als junge, innovative Stadt auch eine Gründerstadt ist.
Ich bin zuversichtlich, dass Freiburg nicht auf platte Parolen und schöne Worte herein fällt, und einem Oberbürgermeister, der zusammen mit der Gemeinderatsmehrheit und der Bürgermeister*innen-Bank Freiburg als lebendige Stadt gestaltet hat, eine weitere – sicherlich nicht immer kantenfreie – Amtsperiode zutraut.


