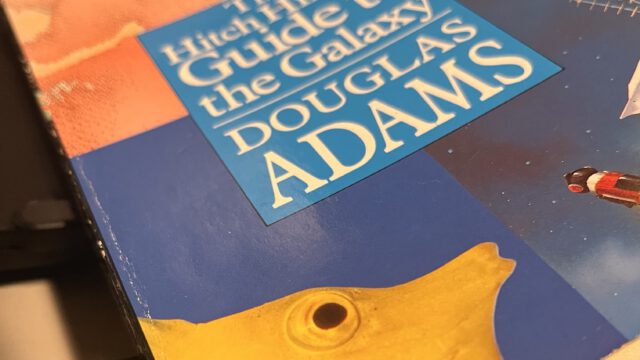Irgendwie hat sich nach meinen letzten Sammelrezensionen doch einiges angesammelt, was ich an SF und Fantasy gelesen und angeschaut habe.
Innovativ fand ich Emily Teshs neuen Roman The Incandescent (2025). Tesh hat 2024 den Hugo für ihre antifaschistische Space Opera Some Desperate Glory bekommen. Ihr neuer Roman ist etwas ganz anderes, aber trotzdem sehr lesenswert. Sie selbst beschreibt ihn als „Naomi Novik’s Scholomance series meets Plain Bad Heroines in this sapphic dark academia fantasy“, das passt schon ganz gut. Ich hätte noch „Hogwarts from teacher perspective“ hinzugefügt. Ein traditionsreiches englisches Internat, an dem Schüler*innen (vor allem aus der Oberschicht, aber es gibt auch ein paar aufgrund besonderer magischer Fähigkeiten dazugenommener Goodwill-Fälle) neben dem üblichen Privatschulcurriculum auch die verschiedenen Arten der Magie kennenlernen, die hier insbesondere mit Transaktionen mit Dämonen zu tun haben. Dr. Walden, die Hauptperson, lehrt eine der Spielarten der Magie, nämlich „Invocation“, also die Beschwörung. Das tut sie mit einer gewissen Begeisterung und viel pädagogischem Ethos – und gleichzeitig ist sie stellvertretende Schulleiterin (o.ä.) und hat einen Haufen organisatorische Aufgaben, zu denen es gehört, das etwas antiquierte Dämonenabwehrsystem der Schule zu prüfen und auf Stand zu bringen. Zeit für eine Liebesgeschichte bleibt da eigentlich nicht, erst recht nicht zu einer Angehörigen der magischen Polizei. Das ist das Spielfeld, auf dem sich ein Roman entfaltet, der nicht nur viel über Schule und Coming of Age zu sagen hat, sondern auch das Genre „magische Schule“ auf den Kopf stellt. Und das höchst unterhaltsam.
The Tainted Cup (2024) von Robert Jackson Bennett ist auf meine Leseliste geraten, weil der Roman 2025 den Hugo gewonnen hat. Strukturell folgt es der Murder Mystery – eine so geniale wie exentrische Detektivin Ana und ihr unerfahreren Assistenten Din (durch dessen Augen wir die Geschichte sehen) müssen einen Mordfall lösen. Nach und nach wird deutlich, dass es um weitaus mehr geht als um den vergifteten Militärangehörigen, der in einer Villa aufgefunden wurde, die einer adeligen Familie gehört: die Nachforschungen könnten das ganze Land erschüttern. Innovativ ist die Fantasy-Welt, das Empire of Khanum, in die Bennett diese Murder Mystery verlegt – zum einen ist da der Kampf des Imperiums gegen die Leviathane, gewaltige Seemonster, die von Festungsanlagen und Mauern in den äußeren Provinzen aufgehalten werden. Zum anderen ist das Grundelement, das das ganze Imperium durchzieht, eine Art magische Gentechnik: es gibt hochspezialisierte Pflanzen, die als Baumaterial, Medizin oder Diebstahlsicherung verwendet werden. Und eine der hierarchischen Kasten zielt vor allem darauf, bestimmte Eigenschaften in Genetik von Menschen (und Tieren) zu bringen. Dadurch hat Din ein fotografisches Gedächtnis erhalten – andere sind übermenschlich stark, schnell oder groß. Jede dieser Eingriffe hat Nebenwirkungen, aber weil diese Eingriffe so nützlich sind, und notwendig sind, um das Imperium vor den Leviathanen zu schützen, werden diese ignoriert. Vor diesem Hintergrund – und während der feuchten Jahreszeit, in der die Gefahr eines Leviathan-Angriffs täglich wächst – wird aus dem einfachen Mordfall die Aufdeckung einer Verschwörung mitten in imperialen Verteidigung gegen das Meer.
Kommen wir zu Andy Weirs Project Hail Mary (2021), das schon eine Weile auf meinem Reader rumlag. In gewisser Hinsicht ähnelt das Buch The Martian – ein Mann alleine im All, und nur mit Wissenschaft und allerlei Nerdtum gelingt es, zu überleben. In dem Fall ist der Mann ein Naturwissenschafts-Lehrer, – sorry, milde Spoiler – das All irgendwo bei Tau Ceti, und wir erleben live mit, wie in Flashbacks nach und nach sein Gedächtnis zurückkommt. Und damit auch die Aufgabe, die Menschheit vor außerirdischen Sonnenfressern zu retten. Dann taucht ein zweites, sehr fremdartiges Raumschiff auf (Heimathafen: Eridani 41). Das Problem mit den Sonnenfressern ist verbreiteter als gedacht. Gemeinsam wird eine improvisierte Lösung gesucht (und gefunden). In der Bewertung kann ich mich dem Podcast Das Universum anschließen, da tauchte das Buch in der Jahresendfolge nämlich auch auf: Pageturner, spannend, sehr wissenschaftsorientiert, selbst in der Reise mit 0,93 Prozent der Lichtgeschwindigkeit – aber leider auch sehr „buddy movie“, der Mann kann’s, lässt seine Besserwisserei raushängen, und wählt als Pronomen für den/die Kolleg*in Ingenieur*in aus dem anderen Sternensystem der Einfachheit halber gleich mal „he“. Deutscher Titel „Der Astronaut“ (statt „Himmelfahrtskommando“, was viel passender wäre), und soll wohl dieses Jahr noch als Film in die Kinos kommen. Wer klassische Science Fiction mag, wird hier gut aufgehoben sein.
Wo ich schon bei teils irritierenden Leseerfahrungen bin: The Society of unknowable Objects von Gareth Brown (2025) ist eine Mischung aus Fantay und Agententhriller – Magda hat den Sitz ihrer Mutter in einer Londoner Geheimgesellschaft geerbt. Deren Aufgabe: magische Objekte finden und sicher verwahren. Die sehen aus wie alltägliche Dinge (Schachfiguren, Broschen, Ringe, eine Landkarte), haben aber jeweils ihre besonderen Eigenschaften. Was als Kammerspiel mit teils skurril gezeichneten Persönlichkeiten beginnt, endet mit wilden Verfolgungsjagden in Hong Kong und Amerika, einer Liebesgeschichte und gleich haufenweise düsteren Geheimnissen. Am Schluss wissen wir, was der Ursprung der magischen Objekte ist, und haben eine Ahnung davon, was passiert, wenn sie in die falschen Hände geraten. So ganz warm geworden bin ich mit dem Buch allerdings nicht – manches war dann doch zu platt, die eine oder andere Szene liest sich, als ob eine LLM an ihrer Entstehung beteiligt gewesen wäre, und aus der Prämisse hätte mehr gemacht werden können. (Vielleicht hätte ich doch erst The Book of Doors von Brown lesen sollen – das schneidet in den Bewertungen bei Goodreads etc. deutlich besser ab und steht hier noch auf meiner Leseliste.)
„Science Fiction und Fantasy – Winter Edition 2025/26“ weiterlesen