Die letzten zwei Tage habe ich vor allem damit zugebracht, mich auszukurieren – Ende Januar, fiese Erkältung, eigentlich hätte ich damit rechnen sollen. Fieber, und ab und zu ein Blick in die Twitter-Timeline, die so wirkte, als sei sie soeben einem Paralleluniversum entstiegen. Trump-Bannon setzt um, was Trump im Wahlkampf versprochen hat, und zwar in rasantem Tempo und mit maximaler Schockwirkung. Das wird seine Gründe haben. Ich finde es jedenfalls extrem gruselig, dass mit einem Federstrich Visas außer Kraft gesetzt werden, Menschen aus Flugzeugen gezerrt werden, Familien auseinander gerissen werden und selbst Greencard-Inhaber*innen fürchten müssen, entweder die USA nie wieder verlassen oder nie wieder in diese einreisen zu können. Und, nein: kein hitziger Fiebertraum, leider.
Checks and balances, melting pot, das Einwanderungsland per se – das, was ich in der Schule über die USA gelernt habe, scheint schon lange nicht mehr zu stimmen, und das wird gerade so richtig deutlich. Einziges ermutigendes Licht am Horizont: doch recht deutliche Worte der internationalen Gemeinschaft (und einiger Hightech-Firmen), und vor allem eine extrem aktive Zivilgesellschaft, mit Eilklagen der ACLU, Taxifahrer*innen-Streiks, freiwilligen Rechtsanwält*innen und Demos an Flughäfen. Wenn es eine Stufe gab, die Trump übersteigend konnte, um deutlich zu machen, dass er das ganze Gerede von Mauern, Abschiebung und „America first“ ernst meint, dann sind das die Dekrete, die er in dieser Woche unterzeichnet hat. Wer jetzt noch glaubt, es mit politics as usual zu tun zu haben, muss verdammt naiv sein. (Insofern würde ich mir auch von den US-Demokrat*innen wünschen, sehr bald sichtbar und strategisch fundiert vorzugehen, und nicht aufgrund von parlamentarischen Traditionen etc. z.B. Trumps Personal durchzuwinken. Es ist ernst.)
Jedenfalls: Wählen ändert was. Und es kann auf wenige Stimmen ankommen, die darüber entscheiden, ob am Schluss die eine oder die andere Zukunft steht. Ich glaube, dass das eine Botschaft ist, die auch für die Bundestagswahl im September diesen Jahres wichtig ist. (Die andere Botschaft: manchmal ist notwendig, sich nicht intern zu zerstreiten, sondern zusammenzustehen … gerade in ernsten Zeiten).
Aber eigentlich wollte ich gar nicht über Trump schreiben, sondern über die Bücher, die ich im Januar gelesen habe. Ich habe mir zu Weihnachten einen eBook-Reader gegönnt, seitdem fehlt der Bücherstapel. Deswegen habe ich mir mal aufgeschrieben, was ich so gelesen habe. Dazu gehört Neil Gaimans Essayband The view from the cheap seats, und er schreibt dort unter anderem so schöne Dinge wie das hier (S. 8 und 9, meine Übersetzung).

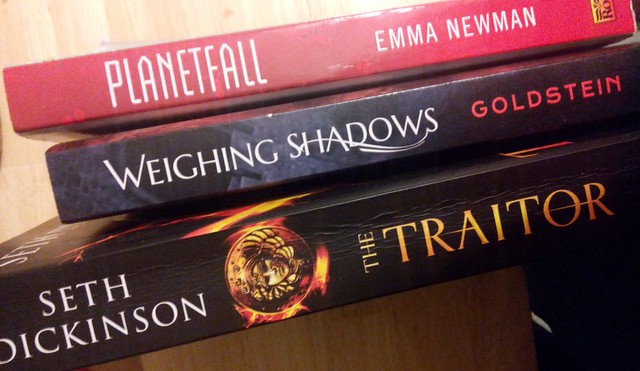

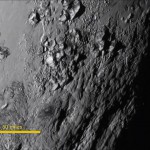 Interessanter sind die inhaltlichen Highlights. So gab es 2015 eine
Interessanter sind die inhaltlichen Highlights. So gab es 2015 eine