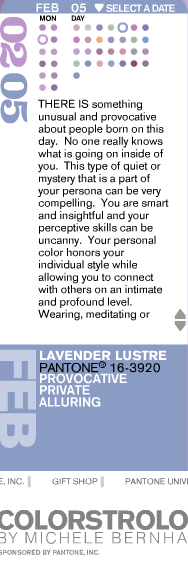In meinem Beitrag Für ein existenzsicherendes Grundeinkommen habe ich es ja schon kurz erwähnt: ein Grundeinkommen macht auch aus der Perspektive eines Zusammendenkens von ökologischer und sozialer Frage Sinn. Reinhard Loske plädiert seit einiger Zeit dafür. Heute hat er einen Kommentar („Den Konsumismus überlisten“) in der taz, der sich hauptsächlich damit beschäftigt, dass es für eine radikal-realistische Klimapolitik nicht ausreicht, Glühbirnen zu verbieten und Hybridautos zu fordern. So schreibt er:
Die Politik muss höllisch aufpassen, dass sie die Klimadebatte nicht zerredet und so klein hackt, dass die Bevölkerung letztlich den Eindruck gewinnt, man könne an der Misere sowieso nichts mehr ändern und konzentriere sich am besten darauf, das eigene Scherflein ins Trockene zu bringen oder die letzte Party zu feiern. Was jetzt gebraucht wird, sind große Würfe, die dann auch verbindlich beschlossen und schrittweise umgesetzt werden: die kohlenstofffreie Energiewirtschaft, klimafreundliche Verkehrsmittel und Gebäude sowie Infrastrukturen, die für jeden ein richtiges Leben im richtigen ermöglichen.
Alle Windräder, Holzpelletheizungen und Hybridautos werden uns aber nicht retten, wenn wir uns länger um die Lebensstilfrage herumdrücken. Da gibt es eine natürliche Scheu, die verständlich ist, gerade bei Politikern, die den Vorwurf der Verzichtspredigt scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Aber der Konsumismus, also das Anhäufen von Gütern als Substitut für Sinn, ist heute der größte Feind des Klimaschutzes. Deshalb ist es eine Kulturaufgabe erster Ordnung, die Rückkehr zum menschlichen Maß zu befördern.
Das nur als Kontext für die hier interessante Frage, wie Grundeinkommen und Klimapolitik zusammenpassen. Als Zwischenschritt dazu argumentiert Loske dazu, nicht klassisch-kapitalismuskritisch und verzichtsbetont an die Frage ökologischer Lebensstile heranzugehen, sondern „den Konsumismus zu überlisten“, d.h.:
[…] Maßhalten mit Lebensfreude, Verzicht mit Genuss, weniger mit mehr, Askese mit Selbstentdeckung zu verbinden, um Mut zu machen und zur Nachahmung anzuregen. Bei der Pluralität unserer Gesellschaft wird das nicht zum Einheitslebensstil führen, sondern zu einer Vielfalt von Lebensstilen, die aber allesamt klimaverträglicher sein würden.
Hier kommt nun das Grundeinkommen ins Spiel, das Loske als Chance sieht, soziale und ökologische Frage zu verbinden und denen, die es wollen, die Möglichkeit zu geben, neue ökologische Lebensstile zu entdecken:
Freilich gilt es eine wichtige Einschränkung zu machen: Wenn Verzicht für die Reichen lediglich hieße, ihren Off-Roader in der Fastenzeit am Sonntag stehen zu lassen, während er für die Armen die Kürzung der Hartz-IV-Leistungen von 345 Euro pro Monat auf 300 Euro bedeutete, wäre ein solcher Ansatz ohne Aussicht auf breite gesellschaftliche Zustimmung. Die Chance, maßvollen Lebensstilen zum Durchbruch zu verhelfen, steigt mit der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, national wie international. Das Grundeinkommen für jede und jeden könnte die Brücke sein, um übermäßigen Wachstumsdruck von der Gesellschaft zu nehmen. Es ist an der Zeit, die ökologische und die soziale Frage endlich zusammenzudenken.
Ich finde das eine ziemlich spannende Perspektive, selbst wenn ich noch nicht davon überzeugt bin, dass ein derartiger Lebensstilwandel auf breiter Front passieren wird. Aber selbst für die von Loske als unzureichend dargestellten Maßnahmen sind Avantgarde-Haushalte sinnvoll, die zeigen, wie ein ökologisch nachhaltiger, emissionsreduzierter und trotzdem genußvoller Lebensstil aussehen kann, und von denen der „raffinierte Kapitalismus“ lernen kann. Um diese möglicherweise anfangs recht kleine Gruppe zu unterstützen, ist ein Grundeinkommen eine gute Idee (jedenfalls besser als die Idee eines Zuschusses für geprüftes ökologisch korrektes Verhalten …).
Anders gesagt: das Grundeinkommen würde einen postmateriellen Lebensstil ermöglichen, und so zu einer verbesserte gesellschaftlichen Ökobilanz beitragen. Der Schritt dazwischen ist der, dass jemand mit Grundeinkommen weniger Zeit für Arbeit und mehr Zeit für „Sein“ haben kann, und die dann idealerweise nicht dafür nutzt, Konsumgüter zu kaufen (und sich zu verschulden), sondern für Kontemplation, Eigenarbeit, ehrenamtliche Arbeit, Familie, Kunst, … andere Formen der Selbstfindung, also jedenfalls alles Dinge, die deutlich weniger materialintensiv sind. Im Prinzip finde ich das eine sehr gute Idee (und habe deswegen auch auf Loskes Beitrag hingewiesen) – allerdings nehme ich an, dass es nur eine relativ kleine Gruppe von Menschen gibt, die ein Grundeinkommen so nutzen würden. Dazu gehört ja beispielsweise, sich nicht über die Erwerbsarbeit zu definieren, etwas mit sich anfangen zu können, ohne externe Unterhaltung geboten zu bekommen usw.
Allerdings bin ich da bei aller Sympathie ein bißchen skeptisch, weil es eine doch recht klare gesellschaftliche Strukturierung in „Milieus“ gibt (z.B. SINUS-Milieus), die jeweils für bestimmte Werthaltungen, für einen bestimmten Lebensstil stehen. Und positive Resonanzen mit einem durch ein Grundeinkommen ermöglichten Lebensstil des „positiven Verzichts“ sehe ich nur bei den Milieus „B12 Postmaterialisten“ und „C2 Experimentalisten“, zusammen sind das maximal 20% der Gesellschaft. Andererseits sind die tatsächlichen Umweltfolgen und die Lebensstile verschiedener Milieus auch noch einmal zwei voneinander getrennt zu betrachtende Dinge.
((Z.T. kopiert aus der grünen Grundeinkommensdebatte))
Warum blogge ich das? Erstens finde ich die Idee interessant, „ökologische und soziale Frage zusammenzudenken“, was auch immer dabei letztlich genau rauskommen wird. Und zweitens beschäftige ich mit in meiner Diss. mit nachhaltigen Lebensstilen und finde diese Debatte auch deswegen spannend.