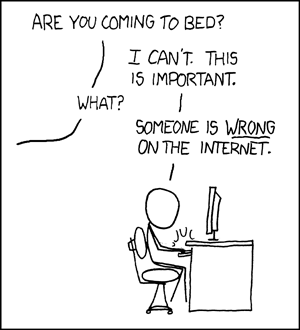Der neuen Familienministerin Kristina Köhler kann einiges vorgeworfen werden, insbesondere scheint sie sich, wenn es um Migration und um die Auseinandersetzung mit dem Islam geht, irgendwo am rechten Rand der CDU zu befinden. Aktuell jedoch geht es in der Debatte vor allem um den Doktortitel der jungen Ministerin. Zum Beispiel hier in der Frankfurter Rundschau. Ausgangspunkt dafür dürfte Kai Diekmann (BILD) sein – um Weihnachten gab es schon einmal Auseinandersetzungen zwischen Diekmann und Köhler, und jetzt ein Interview.
Der neuen Familienministerin Kristina Köhler kann einiges vorgeworfen werden, insbesondere scheint sie sich, wenn es um Migration und um die Auseinandersetzung mit dem Islam geht, irgendwo am rechten Rand der CDU zu befinden. Aktuell jedoch geht es in der Debatte vor allem um den Doktortitel der jungen Ministerin. Zum Beispiel hier in der Frankfurter Rundschau. Ausgangspunkt dafür dürfte Kai Diekmann (BILD) sein – um Weihnachten gab es schon einmal Auseinandersetzungen zwischen Diekmann und Köhler, und jetzt ein Interview.
Kern des Ganzen scheint die – bezahlte – Beteiligung eines Assistenten von Köhlers Doktorvater an der Erstellung ihrer Arbeit zu sein. Was Weihnachten noch nach dem großen Skandal klang, wird nach Lesen des Interviews aber dann doch eher zu relativ normalen Prozessen und Praktiken empirischer Wissenschaft. Besagter Assistent hat Daten codiert und in SPSS eingegeben und das Inhaltsverzeichnis und die Formatierung der Dissertation bearbeitet.
Bei Diekmann heißt es dazu:
Nur formatieren, layouten, Datensätze nach ihren Vorgaben abtippen – das kann auch eine Sekretärin. Braucht man dazu einen top-ausgebildeten wissenschaftlichen Assistenten gerade seines Doktor-Vaters?
Interessant ist hier die Gegenüberstellung „Sekretärin“ vs. „top-ausgebildeter wissenschaftlicher Assistent“. Meiner Erfahrung nach sind das – Codierung, Dateneingabe, Formatierungen – Dinge, die im wissenschaftlichen Alltag heute ziemlich selbstverständlich von – geprüften oder ungeprüften – „HiWis“ erledigt werden. Und nicht von SekretärInnen. Dass das nicht unbedingt zur Qualifikation passt, ist ein Hinweis darauf, wie Wissenschaft heute bezahlt und bewertet wird, entspricht aber – wie gesagt, meinen Erfahrungen nach – durchaus dem Alltag wissenschaftlicher Arbeit. Und dass z.B. zwischen zwei Drittmittelprojekten ein wissenschaftlicher Mitarbeiter derartige Tätigkeiten übernimmt, ist so ungewöhnlich nun auch wieder nicht.
Mit diesem Wissen im Hintergrund reduziert sich der angebliche Skandal dann doch deutlich. Interessanter als die Frage, wer Fragebögen layoutet und eingetippt hat, und ob Köhler ihre Dissertation selbst formatiert hat, ist doch der Inhalt. Da kann ich aktuell nichts zu sagen, werde aber vielleicht mal reinschauen. Und mich dann noch einmal zu Wort melden.
Es kann also durchaus sein, dass das folgende Resümee zutrifft:
Und der Deutschlandfunk resümierte, Köhler habe „eine mustergültige Typ-II-Arbeit vorgelegt, also ein Werk, das weniger vom Interesse an der wissenschaftlichen Arbeit, sondern mehr von dem Wunsch nach einem akademischen Titel geprägt ist“.
Für eine Arbeit, die neben einem Bundestagsmandat in kurzer Zeit entstanden ist, kann ich mir das gut vorstellen. Trotzdem – ein Skandal ist das nicht, auch nicht, wenn eine Bundesministerin daran beteiligt ist. Da gibt es genügend anderes.
Vielmehr stellt sich im Kontext dieser Debatte (auch im Hinblick auf die „gekauften Doktortitel“, die unlängst mal wieder gemeldet wurden) einmal mehr die Frage danach, wozu eigentlich der akademische Doktortitel existiert, und was eine Doktorarbeit ausmacht (und in welche Richtung der Bologna-Prozess hier geht).
Warum blogge ich das? Aus persönlichem Interesse an Promotionsprozessen, und weil ich es interessant finde, wie Skandale gemacht werden – und dabei die eigentlich skandalösen Politiken ausgeblendet werden.