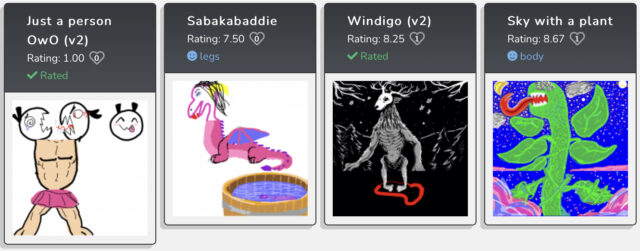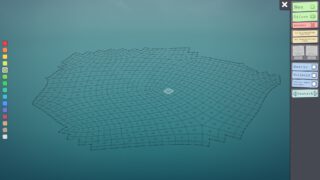Bei mir sammeln sich ja vor allem Bücher an. Und Lego-Modelle. Und natürlich die inzwischen glücklicherweise weitgehend digitalen Fotografien. Ach ja, und Sachen meiner Eltern, die natürlich auch. Das eine oder andere Souvenir. Bilder an den Wänden. Volle Schubladen. Und Stapel auf den Tischen.
Was da eigentlich passiert, damit befasst sich der Kulturhistoriker Valentin Groebner in seinem Essayband Aufheben, Wegwerfen. Vom Umgang mit den schönen Dingen (Konstanz, 2023). Er zieht dabei Bögen von der kleinen Tasche für die eigenen Dinge, die römische Söldner mit sich trugen, über Reflektionen zu Magie (immer etwas, das andere tun könnten, so dass selbst vorgesorgt werden muss) und Schönheit bis hin zu den den vielfältigen globalen Verflechtungen, Exporte, Importe und Re-Importe der letzten tausend Jahre. Groebner macht das in einem freundlichen Erzählstil, mit gelehrtem Spott und einem Hauch Selbstironie über die distinguierte Welt der Sammler*innen und die Kulte des Minimalismus mit ihren weißen Wänden (schwer zu putzen) und den sich doch wieder ansammelnden Dingen in den Augenblicken, in denen Leben stattfindet.
Das ist auf jeden Fall schön zu lesen. Es finden sich hübsche Formulierungen wie die, dass wir Mollusken gleichen, die sich einen Panzer aus Dingen schaffen. Und viel zu oft das Gefühl eines Ertapptseins und der Wiedererkennung, auch wenn’s nie ganz genau so wie bei Groebner ist. Ob ich jetzt mehr über den Umgang mit den mit Erinnerung aufgeladenen Dingen weiß, da bin ich mir noch nicht sicher. Rat gibt Groebner nicht. Vielleicht den, dass Schönheit und Zufriedenheit in der Begrenzung liegt, und das Streben nach Vollständigkeit und Bewahrung eher eine Last ist. Die erst im Rückblick zu erkennen ist. We will see.