Die junge Fernsehschaffende Sophie Passmann liefert den passenden Einstieg für meinen Bericht über die re:publica 2018.
Mein Fazit zur #rp18: Digitalisierung: wichtiges Thema, sollten wir mal ran.
 Und spricht damit, ganz unironisch, die größte Schwäche und die größte Stärke der wie immer viel zu vollen (so ungefähr 20.000 Besucher*innen, 500 Panels, 50.000 Tweets und 30.000 Bälle im Bällebad, unzählige Seifenblasen) Veranstaltung an. Die re:publica ist nach wie vor eine Netzpolitik-Konferenz, keine Digitialisierungskonferenz.
Und spricht damit, ganz unironisch, die größte Schwäche und die größte Stärke der wie immer viel zu vollen (so ungefähr 20.000 Besucher*innen, 500 Panels, 50.000 Tweets und 30.000 Bälle im Bällebad, unzählige Seifenblasen) Veranstaltung an. Die re:publica ist nach wie vor eine Netzpolitik-Konferenz, keine Digitialisierungskonferenz.
Also, vielleicht ist das. Vielleicht habe ich auch wieder mal nur die falschen Panels erwischt/ausgesucht.
Am zweiten re:publica-Tag war dieser Unterschied zwischen Digitalisierung und Netzpolitik für mich eher so ein vages Gefühl. Auch, weil sich ganz viel gar nicht so anders anfühlte und anhörte, als bei meinem letzten re:publica-Besuch. Und der ist schon fünf Jahre her.
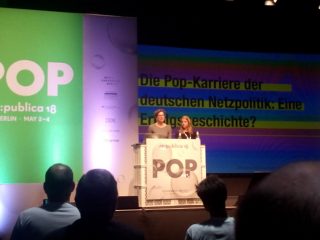 Heute hörte ich dann einen Vortrag von Jeanette Hofmann, Urgestein der Netzforschung in Deutschland, und Ronja Kniep, beide vom Wissenschaftszentrum Berlin, der ganz gut zu diesem vagen Gefühl passte und das ordentlich akademisch kontextualisierte. Die beiden gingen der Frage nach, ob Netzpolitik in Deutschland ein ordentliches Politikfeld ist. Dafür braucht es, so der theoretische Hintergrund, insbesondere ein gesellschaftlich akzeptiertes Schutzgut. Also sowas wie „Netzfreiheit“.
Heute hörte ich dann einen Vortrag von Jeanette Hofmann, Urgestein der Netzforschung in Deutschland, und Ronja Kniep, beide vom Wissenschaftszentrum Berlin, der ganz gut zu diesem vagen Gefühl passte und das ordentlich akademisch kontextualisierte. Die beiden gingen der Frage nach, ob Netzpolitik in Deutschland ein ordentliches Politikfeld ist. Dafür braucht es, so der theoretische Hintergrund, insbesondere ein gesellschaftlich akzeptiertes Schutzgut. Also sowas wie „Netzfreiheit“.
Kurzer historischer Abriß: In den 1980ern gab’s, netzpolitisch gesehen, auf der einen Seite das staatliche Bundespostmonopol, auf der anderen Seite eine Computersubkultur (Hacker, CCC, Foebud, FifF etc.), und ein paar akademische Fans der neuen Technik (erste E‑Mail in Deutschland an der Uni Karlsruhe). Nischen und Infrastrukturpolitik also.
In den 1990er Jahren geht’s auf der Datenautobahn in die Informationsgesellschaft. Der Telekommunikationsmarkt wird liberalisiert, und überhaupt dominieren wirtschaftliche Sichten auf das Netz, das jetzt als Arena für verschiedene Dienstleistungen diskutiert wird.
Mit den 2000er Jahren tritt erstmal die Netzpolitik als eigenständiger Politikbereich ins Licht der Öffentlichkeit. Beckedahl und Notz, Freiheit-statt-Angst-Demos, eine Zensursula-Bewegung, der Aufstieg (und Fall) der Piratenpartei. Auch die 1980er-Subkultur-Initiativen tauchen, teils in gewandelter Form, wieder auf. Datenschutz kommt dazu. Insgesamt wird die Idee, dass ein freies und offenes Netz etwas schützenswertes sein könnte, also ein Schutzgut, zum gesellschaftlich akzeptierten Deutungsmuster. Die Netzpolitik, wie wir sie kennen, ist geboren. Und gebloggt wird auch darüber.
Die 2010er Jahre sind dann in dieser kurzen Geschichte der Pendelschlag zurück. Klar, die Datenschutzgrundverordnung und der Cambridge-Analytica-Skandal sind in aller Munde, aber noch wichtiger sind „Digitalisierung“ – vor allem wirtschaftlich gedacht – und „Cybercrime“ bzw. „Cybersecurity“, also sicherheitspolitische Überlegungen. Netzpolitik als eigenes Politikfeld verliert an diskursiver Deutungsmacht – und damit verändert sich auch der politische Möglichkeitsraum. (Und das, so Hofmann, ist ein deutlich größeres Problem als die Frage Digitalisierungsministerium ja/nein).
Soweit der holzschnittartige Abriß des schon auf nur dreißig Minuten gekürzten Vortrags von Hofmann und Kniep über ihre Forschungsarbeit. Eine Session von ein paar hundert, voll, aber nicht auf der ganz großen Bühne.
Und irgendwie trifft diese Unterscheidung eben ganz gut auf meine Wahrnehmung der diesjährigen re:publica zu. Disclaimer: das mag an meiner Auswahl an Veranstaltungen gelegen haben – vielen Medienpolitik und Medienmacher*innen, ein bisschen Konzept- und Aktionskunst, einiges zu Open Culture und auch ein bisschen was zu Datenschutz. Vielleicht würde mein Bild ganz anders aussehen, wenn ich mir mehr der „Partnersessions“ der Werbepartner angeschaut hätte (ein Vortrag einer Autodesk-Frau zu den Potenzialen von Robotern und KI für den Bau einer besseren Welt ging in diese Richtung), oder die Tracks zu Arbeit oder Gesundheit.
In meiner Panel-Auswahl, und auch in einigen Gesprächen, war es aber so, dass in den Panels viel über Netzpolitik geredet wurde – alles mögliche, was mit dem medialen Kommunikationsraum Netz, den dort bewegten Daten und ihrem Schutz sowie mit der darunterliegenden Soziotechnik zu tun hatte – und kaum über Digitalisierung. (Und um den Umgang mit rechtem Hass im Netz, vielleicht war dass das eigentliche große Thema). Jedenfalls: um das freie und offene Netz, um die „Zurückeroberung“ des Internets.
Ganz anders das Bild, das sich auf dem Gelände bot: schon am Eingang begrüßte der Postbot*innen hinter her fahrende Postbot, eine schnuckelige Art Getränkebox auf Rädern. An mindestens jedem zweiten Stand hingen VR-Brillen. Und zwischen Bitcoin-Startups und Tech for Good, neuer Arbeitswelt und Google-AIs ging es an den Ständen um Digitalisierung, wie das halt heute so gemacht wurde.
Vielleicht wäre Sepia als Leitfarbe besser gewesen als das poppige Grün der Green Screens. Nostalgie für den utopischen Kommunikationsraum, um den „wir“ in den 2000er Jahren gekämpft haben. Vertrautheit mit dem Tagungsort, der STATION Berlin. Selbst das WLAN erkannte einen wieder. Oder doch Begeisterung darüber, wie normal das alles inzwischen ist?
Warum blogge ich das? Hey, ein re:publica-Besuch ohne Blogpost dazu wäre ja irgendwie schräg.

 Und spricht damit, ganz unironisch, die größte Schwäche und die größte Stärke der wie immer viel zu vollen (so ungefähr 20.000 Besucher*innen, 500 Panels, 50.000 Tweets und 30.000 Bälle im Bällebad, unzählige Seifenblasen) Veranstaltung an. Die re:publica ist nach wie vor eine Netzpolitik-Konferenz, keine Digitialisierungskonferenz.
Und spricht damit, ganz unironisch, die größte Schwäche und die größte Stärke der wie immer viel zu vollen (so ungefähr 20.000 Besucher*innen, 500 Panels, 50.000 Tweets und 30.000 Bälle im Bällebad, unzählige Seifenblasen) Veranstaltung an. Die re:publica ist nach wie vor eine Netzpolitik-Konferenz, keine Digitialisierungskonferenz. 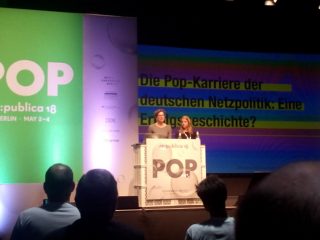 Heute hörte ich dann einen Vortrag von Jeanette Hofmann, Urgestein der Netzforschung in Deutschland, und Ronja Kniep, beide vom Wissenschaftszentrum Berlin, der ganz gut zu diesem vagen Gefühl passte und das ordentlich akademisch kontextualisierte. Die beiden gingen der Frage nach, ob Netzpolitik in Deutschland ein ordentliches Politikfeld ist. Dafür braucht es, so der theoretische Hintergrund, insbesondere ein gesellschaftlich akzeptiertes Schutzgut. Also sowas wie „Netzfreiheit“.
Heute hörte ich dann einen Vortrag von Jeanette Hofmann, Urgestein der Netzforschung in Deutschland, und Ronja Kniep, beide vom Wissenschaftszentrum Berlin, der ganz gut zu diesem vagen Gefühl passte und das ordentlich akademisch kontextualisierte. Die beiden gingen der Frage nach, ob Netzpolitik in Deutschland ein ordentliches Politikfeld ist. Dafür braucht es, so der theoretische Hintergrund, insbesondere ein gesellschaftlich akzeptiertes Schutzgut. Also sowas wie „Netzfreiheit“. 