Kurz: Promovierende mit Kind zwischen den Kategorien

Meine Partnerin und ich sind derzeit beide Promotionsstudierende. Das hat verschiedene Vor- und Nachteile, um die es hier aber gar nicht gehen soll. Ein Problem dieses Status ist mir heute morgen schmerzlich bewusst geworden. Wir sind nämlich (schon länger) auf der Suche nach einem Kita-Platz für Rasmus. Eigentlich hätten wir gerne schon längst einen – Rasmus ist gerade ein Jahr als geworden – aber da wir ihn nicht vorgeburtlich schon auf Wartelisten setzen lassen haben, zieht sich das alles hin.
Aber zum Statusproblem: die Uni Freiburg hat eine eigene Kita (soweit ja mal gut). Die ist voll, wir stehen auf der Warteliste, haben aber wenig Hoffnung, einen Kita-Platz zu ergattern, weil die Plätze dort in der Reihenfolge „wiss. Mitarbeiterinnen“*, „wiss. Mitarbeiter“, „Promovierende“ vergeben werden, wie ich heute morgen erfahren habe.** Das Studentenwerk betreibt auch Kindertagesstätten. Dort ist die Reihenfolge „Studierende im Erststudium“ und erst danach „Promovierende etc.“. Macht beides aus sich heraus Sinn – zusammen führt es dazu, dass die Chance, als promovierende Eltern ohne Beschäftigtenstatus einen Kita-Platz an der Uni zu kriegen, ziemlich klein sind. Was – „akademische Rushhour“ hin und „familienfreundliche Uni“ her – ziemlich blöd ist.
* Nebenbei ein schönes Beispiel für Reifizierungsprobleme: aus der gegenwärtigen geschlechtsspezifischen Arbeitsverteilung heraus erscheint es durchaus sinnvoll, Kita-Plätze bevorzugt an die Kinder von Wissenschaftlerinnen zu geben – gleichzeitig verstärkt diese Reihenfolge aber die gesellschaftliche Annahme, dass Wissenschaftler einen geringeren Bedarf an Kinderbetreuung haben, weil ja im Zweifelsfall die Frau einspringen kann.
** Damit das nicht in den falschen Hals gerät: der Mitarbeiter, der mich darüber informiert hat, war sehr freundlich und hatte durchaus Einsicht in die sich daraus ergebenden Probleme (und nannte auch einige Alternativen außerhalb der Uni) – das strukturelle Problem besteht trotzdem weiter.
Photo of the week: Catching snowflakes III
Neu kaufen oder reparieren lassen? Diesmal: mein Fotoapparat
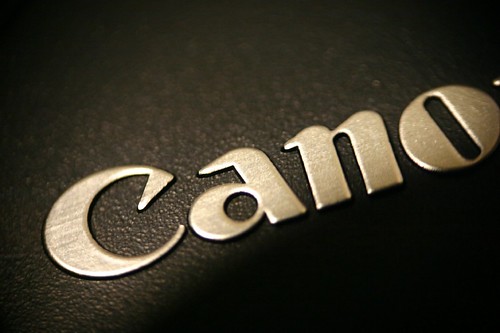
Seit März 2005 (Foto einer Blindschleiche – eines der ersten Bilder) habe ich die Canon EOS 300D – für mich immer noch eine der besten digitalen Spiegelreflexkameras im noch einigermaßen bezahlbaren Preissegment. Seitdem habe ich ziemlich genau 25.000 Fotos damit gemacht. Pünktlich zum Ende des grünen Neujahrsempfangs am 16.1. diesen Jahres gab es dann komische Geräusche und keine Bilder mehr (was nicht nur aufgrund des gleich noch ausgeführten Punktes schade ist, sondern weil es wunderbares sonniges Winterwetter und ein tolles Landschaftspanorama in Kirchzarten gab, dass ich – neben diversen PolitikerInnen – auch gerne noch fotografiert hätte).
Heute kam nun der Kostenvoranschlag – eine Reparatur würde 184 € kosten (abzüglich der 30 €, die für das Erstellen des Kostenvoranschlags zu zahlen waren, und die damit wohl verrechnet werden, wenn ich das richtig verstanden habe). Das ist ziemlich viel Geld. Eine neue Canon EOS 450D oder 500D – also das aktuelle Modell in der gleichen Reihe – kostet etwa drei- bis viermal so viel. Und bietet einige verlockende Eigenschaften. Gar nicht so sehr die natürlich in den letzten fünf Jahren rasant gewachsenen Megapixel, sondern eher der deutlich ausgebaute ISO-Bereich. Bei der Canon EOS 300D ist bei 1600 ISO Schluss, und das gibt schon sehr verrauschte Bilder – die 450D und erst recht die 500D gehen deutlich weiter. Faktisch heißt das, dass es möglich ist, auch bei relativ schlechten Lichtverhältnissen noch ohne Blitz zu fotografieren. Mach(t)e ich zwar bisher auch schon, aber weil eben nur bis 800 ISO noch einigermaßen rauschfreie Bilder rauskamen, bedeutete das im Umkehrschluss Verschlusszeiten von 1/8 bis zu einer Sekunde. Und so lange halten Menschen normalerweise nicht still – weder die, die nachher auf dem Bild zu sehen sein sollen, noch der, der den Fotoapparat in der Hand hält.
Für mich ich klar, dass ich weiterhin mit einer digitalen Spiegelreflexkamera fotografieren möchte. Ich habe zwar noch eine kleine „Point-and-Shot“-Kamera, aber die Qualität ist (obwohl die bei den Megapixeln etc. deutlich besser abschneidet) doch stark unterschiedlich. Besonders deutlich wird das bei Makroaufnahmen und überall, wo Tiefenschärfe (also der verschwommen werdende Hintergrund) eine Rolle spielen.
Damit stehe ich jetzt vor der Entscheidung: Neukauf des Nachfolgemodells oder Reparatur der EOS 300D? Für einen Neukauf sprechen die Verbesserungen gegenüber der 300D. Andererseits sind ungefähr 500 € doch relativ viel, und ich weiss nicht, ob ich die jetzt ausgeben will (oder ob nicht z.B. ein lichtstärkeres Objektiv eine bessere Investition wäre).
Für eine Reparatur spricht neben der monetären Frage vor allem mein ökologisches Gewissen: ich habe keine Ahnung, wie die Ökobilanz einer Digitalkamera aussieht, aber der langfristige Gebrauch ist auf jeden Fall sinnvoll – da hätte ich eigentlich auch gerne ein Modell, das auch entsprechend gebaut ist. Das würde dann aber vermutlich doch deutlich mehr kosten als die aktuellen dreistelligen Canon-Modelle. Der EOS 300D ist der intensive Gebrauch inzwischen durchaus anzusehen – im Fotogeschäft wurden erstmal die Kratzer am Gehäuse und am Griff notiert. Das hat aber auch was damit zu tun, dass viel Kunststoff verbaut ist – auch in der Mechanik.
Jedenfalls stehe ich jetzt vor der Frage „Neu kaufen oder reparieren lassen?“ und kann mich nicht so recht entscheiden. Für Inputs sowohl dazu wie auch zur Qualität der 450D/500D wäre ich daher dankbar.
Warum blogge ich das? Crowdsourcing – und weil’s ein schönes Beispiel für Entscheidungspunkte in nachhaltigen Lebensstilen darstellt.


