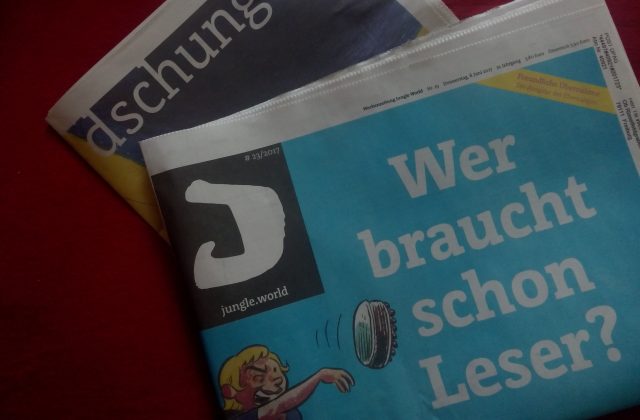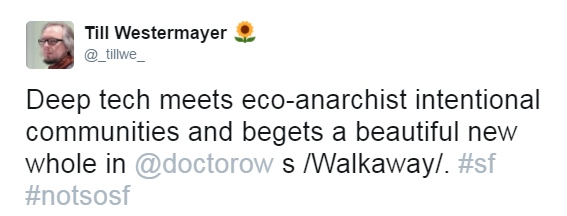Mein Juli war recht lesereich, zumindest was den Bereich Science Fiction und Fantasy angeht. Und natürlich bewahrheitete sich dabei einmal mehr, dass Science Fiction vor allem von der Gegenwart handelt.
Wie beispielsweise in Stephen Gaskells Anthologie Tales from the Edge: Escalation (die ich auch gekauft habe, weil eine Geschichte darin von Alaistar Reynolds stammt). Der gemeinsame Hintergrund für die hier versammelten, schnell gelesenen Storys ist ein Planeten und Sonnensysteme verschlingender „Maelstrom“. Ein solches Ereignis löst Evakuierungen und Fluchtbewegungen aus, und auch religiöse Kulte blühen auf. Wer kann es sich leisten, einen Platz auf einem der Evakuierungsraumschiffe zu bekommen? Wer erschwindelt sich einen? Was ist der Preis dafür – und wie geht es danach weiter?
Auch in Tomorrow’s Kin von Nancy Kress bildet ein katastrophales Ereignis den Hintergrund einer Geschichte, in der es – in diesem Fall – um Vertrauen, Politik und Wissenschaft im Spätkapitalismus geht. Technologisch überlegene Cousinen der Menschheit landen vor New York, um vor einer drohenden Begegnung der Erde mit einer interplanetaren Sporenwolke zu warnen. Sie rufen dazu auf, in einer gemeinsamen wissenschaftlichen Anstrengung ein Gegenmittel zu entwickeln. Die Protagonistin ist eine mäßig erfolgreiche Wissenschaftlerin, die durch einen Zufall zum Teil des Teams wird, das hier zusammenkommt. Aber ist es richtig, den außerirdischen Cousinen zu vertrauen? Gibt es diese Sporenwolke wirklich – und warum existiert nicht längst ein Gegenmittel? Der Handlungsbogen dieses ersten Bandes erstreckt sich über mehrere Jahre, schlägt dabei einige Volten und hat mich bis zum Schluss nicht kalt gelassen.
Dass es in Charles Stross’ Delirium Brief, dem neusten Band der Laundry-Serie (Horror meets britische Bürokratie), ebenfalls um Katastrophales geht, ist nicht verwunderlich. Nachdem die Existenz der Laundry im letzten Band öffentlich bekannt wurde, geht es jetzt darum, mit den politischen Folgen umzugehen – Regierungskommissionen, Talkshows, rollende Köpfe und ein Prozess, der im Outsourcing dieser Behörde münden wird. Hier liegt dann auch der wahre Horror … (nebenbei bemerkt: die Laundry würde sich hervorragend für eine Serienverfilmung eignen).
Ein weiterer Band einer Serie ist Luna: Wolf Moon von Ian McDonald. „Game of Thrones“ auf dem Mond würde für einige der Entwicklungen, die sich aus dem Regimewechsel am Ende des ersten Bandes (Luna: New Moon) ergeben, durchaus auch passen. Wie Mond und Erde sich näherkommen, und wie die Intrigen der lunaren Familienkonzerne sich weiterspinnen, ist lesenswert – insbesondere, weil McDonald es hier, wie auch in vielen seiner früheren Bücher, schafft, eine ganz eigene, synkretische Kultur lebendig werden zu lassen, in der er Elemente, die er z.B. afrikanischen, brasilianischen, australischen und asiatischen Lebenswelten entnommen hat, mit ganz neuen Erfindungen, wie sie nur in der Niedrig-Gravitations-Gesellschaft des Mondes entstehen können, zusammenbringt, und zu einem überzeugenden Ganzen zusammenwachsen lässt. Seine Mondzukunft ist im Großen alles andere als eine Utopie (wie gesagt, gewisse Grundstrukturen erinnern an „Game of Thrones“) – die eine oder andere utopische Nische findet sich allerdings doch.
Last but not least: Ada Palmer war mir bisher kein Begriff. Durch Zufall bin ich auf ihre beiden Bände Too Like The Lightning und Seven Surrenders gestoßen und bin hin- und hergerissen, was ich davon halten soll. Die Historikerin Palmer entwirft eine postnationale Zukunft, einige hundert Jahre nach unserer Gegenwart. Dass der Nationalstaat hier an Bedeutung verloren hat und teilweise durch andere Instanzen ersetzt wurde, erinnert an Malka Olders Infomocracy. Jede und jeder kann wählen, welcher der hier sieben weltumspannenden Einheiten er oder sie zugehörig ist. Da und dort schimmern noch einzelne regionale Bündnisse (die EU), globale Konzerne (Mitsubishi-Greenpeace) oder andere Vorbilder (die olympischen Spiele und deren Vermarktung, das römische Reich, die scientific community) als Kerne dieser Postnationen durch. Die Zukunft ist rationell – Geschlecht ist tabuisiert und zugleich fluide, Familien sind durch Wahlverwandschaften und kommunale Lebensformen ersetzt, Religion ist nach schrecklichen Religionskriegen höchstprivat, und Probleme wie der Verkehr (computergesteuerte suborbitale Taxis) oder der Umgang mit Verbrecher*innen (fürsorgliche Versklavung) haben kluge Lösungen gefunden. Computer und Mensch-Computer-Hybride sorgen für optimale Steuerung. Doch hinter dieser heilen Oberfläche taucht eine Parallelwelt der Reichen und Mächtigen auf, die in barock anmutender Ausschweifung durch Sexualität, Religiösität, philosophische Lektüre und andere Tabubrüche zusammengehalten wird. Dazu kommen fast schon mystische Begebenheiten. Der (eigenwillige und sicherlich nicht besonders zuverlässige) Erzähler büßt für ein brutales Verbrechen, und ist doch zugleich derjenige, der nach und nach die Puzzlesteine der zunächst nach Krimi aussehenden Geschichte zusammensetzt. Spannend ist Palmers Serie (ein dritter Band erscheint demnächst) auch durch diese Geschichte – vor allem aber wirft der Roman Fragen dazu auf, was das konsequente Weiterdenken heutiger Entwicklungen bedeuten würde. Die Antworten faszinieren, stoßen aber zugleich ab.