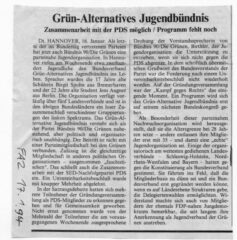Ich bin schon seit geraumer Zeit dabei, die Ordner, die ich von Umzug zu Umzug mitgeschleppt habe, zu digitalisieren. Andere Menschen würden vermutlich eher zu „kann doch weg“ tendieren, ich habe, und wenn ich mir unseren Keller anschaue: durchaus familiär beeinflusst – eher eine Tendenz zum Aufheben. Also: Ordner digitalisieren, alles mögliche kommt in den Doppelseiteneinzugsscanner (lang lebe DIN A4), und viel Volumen hat natürlich die Studienzeit eingenommen.
In den letzten Wochen bin ich nun im Gang rückwärts in der Zeit um 1993 angekommen. 1994 habe ich Abi gemacht, danach Zivildienst und dann im Herbst 1995 angefangen zu studieren. Parallel war ich zu dieser Zeit auf Landesebene in der damaligen Grün-Alternativen Jugend (GAJ) aktiv, es gab auch eine Freiburger Ortsgruppe (zusammen mit den letzten Resten von JungdemokratInnen/Junge Linke), und Schülerzeitung, SMV – mit lokalpolitischen Bezügen, eine Meinungsumfrage zum Bürgerentscheid „Litzfürst“ schaffte es sogar in die Schulkonferenz – und 1994 gründete sich das Grün-Alternative Jugendbündnis GAJB, der Vorläufer der heutigen Grünen Jugend. Viel los in dieser Zeit also. Und vieles, was ich vergessen hatte …
1993 habe ich angefangen, systematisch Zeitungsausschnitte zu sammeln (und das bis Ende 1995 fortgeführt, danach wurde es dann in Bezug auf die Zeitungsausschnitte unsystematischer und in Bezug auf alles, was soziologisch oder digitalpolitisch interessant war, systematischer – schließlich fing dann mein Studium an, und ich kam mit Bibliografien und der Idee von Literaturverwaltungssoftware in Kontakt). Und dieser Ordner Presse von 1993 bis 1995 ist in mehrfacher Hinsicht interessant.
Biografisch, weil er einen ganz guten Überblick gibt, was mich damals, in einer sicherlich sehr prägenden Zeit, interessiert hat. Und zum anderen auch mit Blick auf die Wiedergänger. Viele Debatten tauchen heute, dreißig Jahre später, wieder auf. Ich will das an ein paar Beispielen verdeutlichen:
 1993, gleich der erste aufgehobene Artikel, ist aus der Badischen Zeitung und berichtet über eine „Schüler-Demo gegen Fremdenhaß“ mit gut 1000 Teilnehmenden („Enttäuschung über die geringe Teilnehmerzahl“). Interessant in dem Zusammenhang auch ein Flugblatt des Freiburger Kreisverbands der Grünen, das ich als Konzeptpapier zum Aufkleben der Presseschnippsel verwendet hatte. Das dürfte ebenfalls aus dem Jahr 1993 oder 1994 stammen und trägt den Titel: „Der Feind steht rechts!“ (ein Zitat des Reichskanzlers Wirth, 1922). Sammelunterkünfte für Asylsuchende ebenso wie die politische Annäherung der CDU an die damaligen „Republikaner“ werden thematisiert. Klingt leider alles brandaktuell.
1993, gleich der erste aufgehobene Artikel, ist aus der Badischen Zeitung und berichtet über eine „Schüler-Demo gegen Fremdenhaß“ mit gut 1000 Teilnehmenden („Enttäuschung über die geringe Teilnehmerzahl“). Interessant in dem Zusammenhang auch ein Flugblatt des Freiburger Kreisverbands der Grünen, das ich als Konzeptpapier zum Aufkleben der Presseschnippsel verwendet hatte. Das dürfte ebenfalls aus dem Jahr 1993 oder 1994 stammen und trägt den Titel: „Der Feind steht rechts!“ (ein Zitat des Reichskanzlers Wirth, 1922). Sammelunterkünfte für Asylsuchende ebenso wie die politische Annäherung der CDU an die damaligen „Republikaner“ werden thematisiert. Klingt leider alles brandaktuell.
 Dann beschäftigen sich 1993 einige Artikel mit dem Jugendumweltfestival Auftakt in Magdeburg, an dem ich auch teilgenommen hatte. Umweltthemen nehmen in der Sammlung einen großen Raum ein – Presseberichte zu diversen Protesten (Castortransporte!) ebenso wie zum 1995 in Freiburg stattfindenden Jugendumweltkongress Jukß mit 1200 Jugendlichen aus ganz Deutschland. Für eine autofreie Rempartstraße wurde ebenfalls demonstriert … auch das ein Thema, das sich trotz Verbesserungen in der Verkehrsführung noch nicht erledigt hat. Oder wie hier zu sehen im September 1995 eine Demo zu den damaligen Atomtests Frankreichs auf dem Mururoa-Atoll. (Und ja, der junge Mann mit den langen Haaren links bin ich … da hat sich in den 30 Jahren seitdem auch ein bisschen was geändert …).
Dann beschäftigen sich 1993 einige Artikel mit dem Jugendumweltfestival Auftakt in Magdeburg, an dem ich auch teilgenommen hatte. Umweltthemen nehmen in der Sammlung einen großen Raum ein – Presseberichte zu diversen Protesten (Castortransporte!) ebenso wie zum 1995 in Freiburg stattfindenden Jugendumweltkongress Jukß mit 1200 Jugendlichen aus ganz Deutschland. Für eine autofreie Rempartstraße wurde ebenfalls demonstriert … auch das ein Thema, das sich trotz Verbesserungen in der Verkehrsführung noch nicht erledigt hat. Oder wie hier zu sehen im September 1995 eine Demo zu den damaligen Atomtests Frankreichs auf dem Mururoa-Atoll. (Und ja, der junge Mann mit den langen Haaren links bin ich … da hat sich in den 30 Jahren seitdem auch ein bisschen was geändert …).
Atomtests ist so ein Wiedergänger-Thema, denn gerade jetzt hat Trump ankündigt, die amerikanischen Atombomben-Tests wieder aufnehmen zu wollen. Nicht nur in dieser Hinsicht gibt es gewisse Parallelen. Und auch wenn „Klima“ Mitte der 1990er Jahre noch nicht das beherrschende Thema war, so kommt die Klimakrise doch vor; 1997 wird es dann zum Kyoto-Protokoll kommen, als erster Schritt auf dem Weg hin zu globalen Reduzierung der Treibhausgasemissionen.
Dabei deutet sich in der Sammlung der Presseausschnitte auch schon eine Hinwendung zur Wissenschaft an: sind es anfangs eher die aktivistischen Themen, kommt – auch durch den Zivildienst im Öko-Institut – nach und nach auch der eine oder andere Bericht zu Umweltbilanzen, Ökolabels und ähnlichen Fragen in den Pressespiegel.
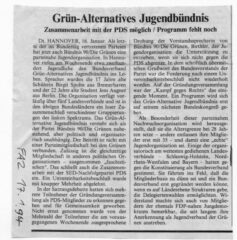 Jugendpolitische Aktivitäten im engeren Sinne spielen natürlich eine große Rolle. So geht es um die damals anstehende Abschaffung des 13. Schuljahrs (Baden-Württemberg führt es dieses Jahr wieder ein) – die „Regionale SchülerInnen-Versammlung“ mit Alexander Bonde (dann Vorsitzender des Landesschülerbeirats, später MdB und dann Landwirtschaftsminister in Baden-Württemberg, heute Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt) organisiert dazu einige Aktionen. Und Franziska Brantner (heute MdB und grüne Bundesvorsitzende) gibt ein erstes Interview als 15-jährige, in der sie erklärt, was die Jugendkonferenz der Stadt Freiburg bringen soll, und warum es wichtig ist, Jugendlichen selbst Gehör zu schenken. Die Gründung des Grün-Alternativen Jugendbündnisses nimmt Raum ein (die FAZ guckt genau, ob es eine Abgrenzung zur damaligen „PDS“ gibt, oder ob hier linksradikale Umtriebe zu befürchten sind), und ebenso finden sich Ausrisse zu Querelen bei den Jusos, einem Empfang der Landesregierung unter Ministerpräsident Teufel für Jugendorganisationen und dergleichen mehr.
Jugendpolitische Aktivitäten im engeren Sinne spielen natürlich eine große Rolle. So geht es um die damals anstehende Abschaffung des 13. Schuljahrs (Baden-Württemberg führt es dieses Jahr wieder ein) – die „Regionale SchülerInnen-Versammlung“ mit Alexander Bonde (dann Vorsitzender des Landesschülerbeirats, später MdB und dann Landwirtschaftsminister in Baden-Württemberg, heute Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt) organisiert dazu einige Aktionen. Und Franziska Brantner (heute MdB und grüne Bundesvorsitzende) gibt ein erstes Interview als 15-jährige, in der sie erklärt, was die Jugendkonferenz der Stadt Freiburg bringen soll, und warum es wichtig ist, Jugendlichen selbst Gehör zu schenken. Die Gründung des Grün-Alternativen Jugendbündnisses nimmt Raum ein (die FAZ guckt genau, ob es eine Abgrenzung zur damaligen „PDS“ gibt, oder ob hier linksradikale Umtriebe zu befürchten sind), und ebenso finden sich Ausrisse zu Querelen bei den Jusos, einem Empfang der Landesregierung unter Ministerpräsident Teufel für Jugendorganisationen und dergleichen mehr.
 Aber nicht alles ist Politik. Zwischen Fotos von Demos und Randnotizen zu Verbänden kommen zunehmend mehr Artikel, die sich mit Digitalisierung beschäftigen (auch hier half der Zivildienst und der Zugang zu diversen Zeitschriften, der damit verbunden war). Erörterungen über Unzulänglichkeit der Metapher der Datenautobahn, Hacker-Porträts und ein Interview mit Joseph Weizenbaum sind nur einige der Fundstücke. Und passend zur vor wenigen Tagen erschienenen letzten Papierausgabe der wochentäglichen taz habe ich auch die damalige Ankündigung der ersten „digiTaz“ aufgehoben – samt Erläuterung, was dieses Internet eigentlich ist, und der eingängigen Adresse
Aber nicht alles ist Politik. Zwischen Fotos von Demos und Randnotizen zu Verbänden kommen zunehmend mehr Artikel, die sich mit Digitalisierung beschäftigen (auch hier half der Zivildienst und der Zugang zu diversen Zeitschriften, der damit verbunden war). Erörterungen über Unzulänglichkeit der Metapher der Datenautobahn, Hacker-Porträts und ein Interview mit Joseph Weizenbaum sind nur einige der Fundstücke. Und passend zur vor wenigen Tagen erschienenen letzten Papierausgabe der wochentäglichen taz habe ich auch die damalige Ankündigung der ersten „digiTaz“ aufgehoben – samt Erläuterung, was dieses Internet eigentlich ist, und der eingängigen Adresse http://www.prz.tu-berlin.de/taz zum Aufruf der digitalen Zeitung. Parallel dazu wird in anderen Zeitungsausrissen darüber spekuliert, ob mit dem baldigen Ende der Zeitung auf Papier und dem papierlosen Büro zu rechnen sei. Hat etwas länger gedauert …
Ein oder zwei Artikel zum Thema Science Fiction waren auch in der Gemengelage vorhanden. Dass mir viele der Dinge, die ich damals interessant fand, weiterhin interessant erscheinen, würde ich ja durchaus positiv werten – dass viele der politischen Probleme, die damals relevant waren, heute immer noch oder wieder relevant sind, erscheint dann schon besorgniserregender. Hier habe ich zunehmend das Gefühl, dass der Fortschritt, wenn es ihn den gibt, sich in Wellen bewegt. Und allein für diese Erkenntnis lohnt es sich doch, das eine oder andere aufzuheben, und sei es platzsparend digital.