Bei Antje Schrupp und bei der Mädchenmannschaft werden die aktuellen Entwicklungen rund um das Sorgerecht analysiert und heftig diskutiert. Mein erster Eindruck: die Aufhebung des Vetorechts für nicht-eheliche Mütter beim Sorgerecht ist ebenso sinnvoll wie der Vorschlag von Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberg, künftig das gemeinsame Sorgerecht auch bei nicht miteinander verheirateten Eltern als Standard einzuführen. Diese Sicht der Dinge mag auch mit meiner persönlichen Situation zu tun haben. Ich bin froh, dass meine Partnerin und ich das gemeinsame Sorgerecht für unsere beiden Kinder haben (diese Möglichkeit gibt es erst seit 1998) – das passt zu unserer Vorstellung egalitärer Elternschaft. Und ich kann bestätigen, was wohl auch andere erfahren haben, dass es nämlich als nicht verheiratetes Paar ein ziemlicher Aufwand ist, das gemeinsame Sorgerecht zu beantragen. Dazu müssen Vater und Mutter gemeinsam beim Jugendamt erscheinen – wir haben das aus praktischen Gründen und nach Beratung durch unsere Hebamme vor der Geburt gemacht -, sich einen Vortrag darüber anhören, dass die Entscheidung nur durch Gerichtsurteil wieder aufhebbar ist, und die Partnerin wird ganz unvolljährig nochmal ganz besonders auf die Tragweite ihres Entschlusses hingewiesen. Dass es unter diesen Umständen häufig dazu kommt, dass unverheiratete Paare das gemeinsame Sorgerecht nicht beantragen, erscheint mir plausibel – und die Karlsruher Entscheidung ein Schritt hin zu einer Gleichstellung von verheirateten und nicht verheirateten Paaren.
Allerdings gibt es auch Argumente, die gegen die Regelung einer gemeinsamen Sorge als Standardfall sprechen, und die mich jetzt auch ein bißchen ins Grübeln gebracht haben. Das eine ist der in diesem taz-Kommentar schön zum Ausdruck gebrachte Punkt, dass „Vaterschaft“ ganz unterschiedliches bedeuten kann, von der egalitären Familienarbeit oder der Alleinverantwortung bis hin zu einem „Will-damit-nichts-zu-tun-haben“: da stellt sich schon die Frage, ob eine solche Festlegung für alle Fälle passt, bzw. wie das geregelt werden kann. Noch schwerwiegender erscheint mir das von beiden oben verlinkten Blogs angesprochene Argument, dass mit der gemeinsamen Sorge von leiblicher Mutter und leiblichem Vater letztlich ein ganz bestimmtes soziales – heteronormatives – Modell von Familie und Elternschaft gefeatured wird, und dass hier die biologische Elternschaft gegenüber einer wie auch immer zustande gekommenen sozialen Elternschaft klar präferiert wird. Jedes Kind braucht Eltern – aber müssen das genau zwei sein, genau ein Mann und genau eine Frau (die zusammen das Kind gezeugt haben)?
P.S.: Wahrscheinlich ist das rechtlich-politische Konzept Familienvertrag hier der letztlich sinnvollste Weg.


 Ein SF-Roman von Ursula K. LeGuin, der im Hainish-Universum spielt. Es handelt sich dabei um den Bericht des »Erstkontakters« Gently Ai (ein Terraner), der versucht, den Planeten Winter/Gethen in die Ekumene einzubinden. Winter ist ein Planet in der Eiszeit, auf dem es zwar Technologien wie Radio, Motoren, etc. gibt, der aber keine industrielle Revolution erlebt hat. Außerdem gibt es keine Männer oder Frauen – die BewohnerInnen(?) sind geschlechtslos, bis auf eine kurze Phase jeden Monat, in dem sie je nach Zufall, Partner etc. männlich oder weiblich werden (Kemmer) und Sex haben können.
Ein SF-Roman von Ursula K. LeGuin, der im Hainish-Universum spielt. Es handelt sich dabei um den Bericht des »Erstkontakters« Gently Ai (ein Terraner), der versucht, den Planeten Winter/Gethen in die Ekumene einzubinden. Winter ist ein Planet in der Eiszeit, auf dem es zwar Technologien wie Radio, Motoren, etc. gibt, der aber keine industrielle Revolution erlebt hat. Außerdem gibt es keine Männer oder Frauen – die BewohnerInnen(?) sind geschlechtslos, bis auf eine kurze Phase jeden Monat, in dem sie je nach Zufall, Partner etc. männlich oder weiblich werden (Kemmer) und Sex haben können.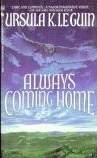 Eine SF-Geschichte, die in einer Zukunft spielt, die auf den Altlasten von heute nach den Ritualen von gestern existiert. Traumhafte und traumartige Beschreibungen der Rituale und der Mythologie eines modernen Indianerstammes, der noch nicht existiert und eines Tages dort leben wird, wo heute noch San Francisco steht. Inklusive eigener Sprache, Kultur, usw. Das Buch ist zum Teil sehr collagenartig geschrieben. Fokus und Hauptperson ist eine Frau, die wir von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tod begleiten.
Eine SF-Geschichte, die in einer Zukunft spielt, die auf den Altlasten von heute nach den Ritualen von gestern existiert. Traumhafte und traumartige Beschreibungen der Rituale und der Mythologie eines modernen Indianerstammes, der noch nicht existiert und eines Tages dort leben wird, wo heute noch San Francisco steht. Inklusive eigener Sprache, Kultur, usw. Das Buch ist zum Teil sehr collagenartig geschrieben. Fokus und Hauptperson ist eine Frau, die wir von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tod begleiten.