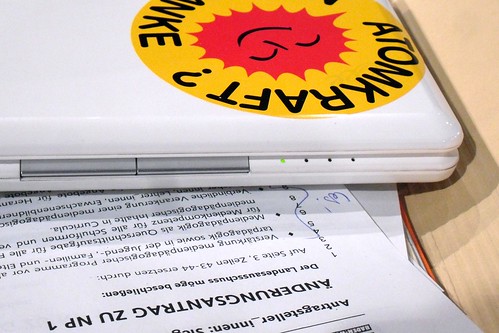Im Rahmen meiner Diss. interessiert mich der „nachhaltige“ Umgang mit Mobiltelefonen (am Freitag hatte ich dazu schon ganz kurz gebloggt).
Im Rahmen meiner Diss. interessiert mich der „nachhaltige“ Umgang mit Mobiltelefonen (am Freitag hatte ich dazu schon ganz kurz gebloggt).
Auf der EASST 2010 in Trento habe ich dazu anhand von Interviews, die ich vor ein paar Jahren durchgeführt habe, und in einer praxistheoretischen Rahmung etwas über die Schwierigkeiten, ein Mobiltelefon nachhaltig zu nutzen. Am Donnerstag werde ich im Rahmen der Tagung „Entscheidungen mit Umweltfolgen zwischen Freiheit und Zwang“ der Nachwuchsgruppe ebenfalls noch einmal etwas zu diesem Thema vortragen, mit etwas anderer Akzentuierung. Ein wichtiger Aspekt sind für mich die soziotechnischen „Zwänge“ gegenüber den Spielräumen für eine nachhaltige Nutzung. Grade eben habe ich bei Twitter schon mal rumgefragt; die Antworten passen ganz gut zu dem, was mir momentan so vorschwebt.
Zum einen sind das unterschiedliche Formen der „nachhaltigen Nutzung“ (in der „1. Welt“ – die Debatte um die das Mobiltelefon als Entwicklungsmotor in Entwicklungs- und Schwellenländern ist nochmal ein ganz anderes Thema). Wer die Liste – die keine Aussage über die tatsächliche Umweltwirkung der aufgelisteten Praktiken sein soll, sondern einfach erstmal eine Sammlung, was Menschen unter nachhaltiger Nutzung verstehen – unten kommentieren oder ergänzen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
- Verzicht auf ein Mobiltelefon
- Nutzung eines „geteilten“ Mobiltelefons, Ausborgen in spezifischen Situationen
- Maximierung der Lebenszeit: Benutzung eines alten/gebrauchten Geräts; kleinere Reparaturen; Ersatz eines defekten Akkus; Verzicht auf Vertragsverlängerungsneugeräte etc.
- Weitergabe bzw. Recycling nach Ende der Gebrauchsphase
- Erreichbarkeit auch mit einem älteren Modell möglich, Verzicht auf energieintensive Funktionen wie WLAN, kein Smartphone
- Auswahl eines Geräts mit einem geringen SAR-Wert, Strahlungsarmut
- Auswahl eines Geräts mit „Öko-Design“ – besonders robust und hochwertig; recycelte Kunststoffe; integrierte Solarzellen
- Minimierung der Nutzung: nur in besonderen Fällen im Einsatz, nicht immer angeschaltet, WLAN nicht immer angeschaltet; bewusst Entscheidung für „teurere“ Tarifstruktur/Prepaid
- (Weitgehender) Verzicht auf Anrufe, Nutzung nur für SMS
- Verwendung von Öko-Strom zum Aufladen
- Nutzung als Informations- und Kommunikationsmedium für nachhaltigen Konsum (vom Webbrowser auf dem Smartphone zu besonderen Apps wie etwa Barcode-Reader mit Produktinformationen oder ortsbasierte Dienste zur Information über Umweltfragen)
Aus der Literatur sind dann noch zwei weitere Formen „nachhaltiger Nutzung“ bekannt, von deren Existenz ich aber noch nicht so ganz überzeugt bin. Das eine wäre sowas wie eine Erhöhung der Nachhaltigkeit des eigenen Lebens dadurch, dass das Mobiltelefon energie- und ressourcenintensivere Dienstleistungen und Produkte ersetzt (ein Beispiel wäre das Mobiltelefon als eBook-Reader vs. eigenständiges Gerät vs. gedrucktes Buch) bzw. die Orts- und Zeitflexibilität, die mit dem Gerät verbunden ist, Mobilität vermeiden lässt (vielleicht geht die Abfrage von Onlinefahrplänen via Handy in diese Richtung).
Das andere Modell, noch einen Schritt weitergehend, wäre das Smartphone als ökologische „Optimierungszentrale“, sowas wie eine laufende Berechnung der eigenen Ökobilanz als Entscheidungsgrundlage. Also die Nutzung entsprechender Informationskanäle nicht in Ausnahmefällen, sondern eingebaut in alltägliche Routinen.
Neben diesen nachhaltigen Nutzungsformen, die mehr oder weniger die Spielräume umreißen, stehen die „Zwänge“. Auch dafür eine (sicherlich) unvollständige und eher unsortierte Liste.
- Kaum Einfluss auf den Produktionsprozess, damit kaum Einfluss auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsfragen (Herstellungsbedingungen, …)
- Abhängigkeit der Handy-Nutzung von großtechnischer Infrastruktur und deren Betrieb (ob der Netzbetreiber für seine Server Ökostrom verwendet, weiss ich nicht und kann ich nicht beeinflussen)
- Vertrags- und Tarifstrukturen (automatisch neue Geräte, automatische Vertragsverlängerung, …)
- Bestimmte Funktionalitäten nur mit neueren Modellen; stetiger Modellwechsel
- Schlechte Reparierbarkeit, begrenzte Lebensdauer
- Notwendigkeit, erreichbar zu sein (z.B. wegen familiärer Koordination, beruflichen Fragen, politischem Machtgewinn)
- Keine funktionalen Äquivalente für bestimmte Funktionalitäten, z.B. Textnachrichten
- Verknüpfung bestimmter Erwartungen mit dem Mobiltelefon – wer eines hat, soll dieses z.B. auch möglichst immer angeschaltet haben, weil Erreichbarkeit zu den sozial durchgesetzten Eigenschaften der Mobiltelefonnutzung gehört; macht z.B. Minimierungsstrategien oder sharing schwierig
- Peer pressure – z.B. Teenager, Mobiltelefon als Objekt, an dem sich reale soziale Gemeinschaften bilden
- Mit zunehmender Veralltäglichung (inzwischen 80–90% der Haushalte …) des Geräts wird „Mobiltelefonnutzung“ die nicht hinterfragte gesellschaftliche „Standardoption“, Verzicht wird massiv begründungsbedürftig
- Universale Generalisierbarkeit mobiler Kommunikationspraktiken macht Begrenzung auf bestimmte Sphären schwierig
- In die Geräte/Verträge eingeschriebene „Sachzwänge“ (welche wären das?)
Vielleicht hat ja jemand Lust, mit mir darüber nachzudenken, ob die beiden Listen – die nicht der Inhalt, aber eine Grundlage meines Vortrags am Donnerstag sein werden – so sinnvoll sind.
Warum blogge ich das? Zur intersubjektiven Vermeidung blinder Flecken.