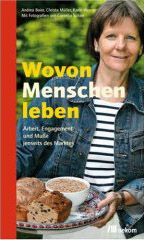 Die Münchener anstiftung ist eine der kleineren, wenig bekannten Stiftungen – umso interessanter erscheint mir das, was dort gearbeitet wird. Ein in jeder Hinsicht handfestes Ergebnis der Arbeit der anstiftung ist das Buch „Wovon Menschen leben. Arbeit, Engagement und Muße jenseits des Marktes“ der Soziologinnen Andrea Baier, Christa Müller und Karin Werner (mit Fotografien von Cornelia Suhan).
Die Münchener anstiftung ist eine der kleineren, wenig bekannten Stiftungen – umso interessanter erscheint mir das, was dort gearbeitet wird. Ein in jeder Hinsicht handfestes Ergebnis der Arbeit der anstiftung ist das Buch „Wovon Menschen leben. Arbeit, Engagement und Muße jenseits des Marktes“ der Soziologinnen Andrea Baier, Christa Müller und Karin Werner (mit Fotografien von Cornelia Suhan).
Ich bin auf dieses Buch gestoßen, weil mich das Thema Nachhaltigkeit und Lebensstile aufgrund meines Promotionsvorhabens beschäftigt. Aber anders als viele andere Bücher zu diesem Themenfeld geht es bei „Wovon Menschen leben“ nun zwar auch um die wissenschaftliche Auseinandersetzung: um einen neuen Begriff von Arbeit, der in der Tradition von Bennholdt-Thomsen die Bedeutung von Subsistenz, also Produktion, die sich am eigenen Leben und nicht am Markt orientiert, in den Vordergrund stellt; um die Frage, wie Subsistenz und das Leben in einer funktional differenzierten Gesellschaft zusammenpasst (oder ob es nicht eben gerade die informellen Zwischenstücke sind, die das Funktionieren einer solchen Gesellschaft erst ermöglichen); um den Zusammenhang zwischen Subsistenz, Individuum und Gemeinschaft; und nicht zuletzt um die Frage, ob Subsistenz (im Sinne der Konsumverzicht positiv wertenden Suffizienzstrategie) zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag führen kann.
Das ist jedoch nur die eine Seite des Buches. Die andere besteht aus 28 Porträts einzelner Menschen und Paare, zu deren Alltag „Arbeit, Engagement und Muße jenseits des Marktes“ gehört. Diese Porträts sind die Grundlage intensiver Interview- und Beobachtungstätigkeit der Forscherinnen, werden hier aber nicht nüchtern präsentiert, sondern die Autorinnen nehmen bewusst Stellung, gehen auf die Position der Befragten ein und stellen diese mitfühlend und „unverhohlen sympathisierend“ dar. Begleitet werden diese Porträts von schönen Fotografien und einer DVD, auf der Videomaterial aus den Interviews enthalten ist. Geordnet haben die Autorinnen die Porträts nach vier Kategorien: „Für andere sorgen“, „Nahraum gestalten“, „Natur erleben – Natur bewahren“, „Selber machen“ – damit sind auch die Themen angesprochen, die das Buch als rote Fäden durchziehen.
Ein bißchen – aber mit anderen Gewichtungen, und einer anderen Aussage – erinnert das Buch an Ulrich Becks „Eigenes Leben“, das ebenfalls auf die Kombination aus Analyse, Porträt und Fotografie aufbaut. Allerdings ist Becks Blick auf die Welt ein anderer. Vielleicht macht folgendes Zitat die Grundhaltung der Autorinnen am besten deutlich:
Wir wollten nicht nach den Defiziten der Menschen Ausschau halten – z.B. ihrer mangelnden Bereitschaft in Sachen umweltbewusstes Handeln -, wir wollten vielmehr wissen, welche positiven Ansätze es für Nachhaltigkeit, sprich die Erhaltung der natürlichen und sozialen Ressourcen, im ganz normalen Alltag ganz normaler Leute gibt. (S. 18)
Auch das Buch selbst ist – vielleicht sogar ein bißchen unüblich für das Thema beim oekom-Verlag – als schön gestaltetes Hardcover erschienen; das passt zur Grundhaltung, die die theoretischen Überlegungen und die Porträts durchzieht: die Vorstellung, dass auch im hier und jetzt ein „gutes Leben“ im besten Sinne möglich ist.
* * *
Andrea Baier, Christa Müller, Karin Werner (2007): Wovon Menschen leben. Arbeit, Engagement und Muße jenseits des Marktes. München: oekom. 301 Seiten plus DVD, Hardcover. 24,90 Euro. Bei Amazon kaufen.
Mit der neuen Rubrik „Lesenswert“ möchte ich kurze Hinweise auf interessante Bücher geben.

 Seit ein paar Wochen ist die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) nun mit einer neugestalteten
Seit ein paar Wochen ist die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) nun mit einer neugestalteten 