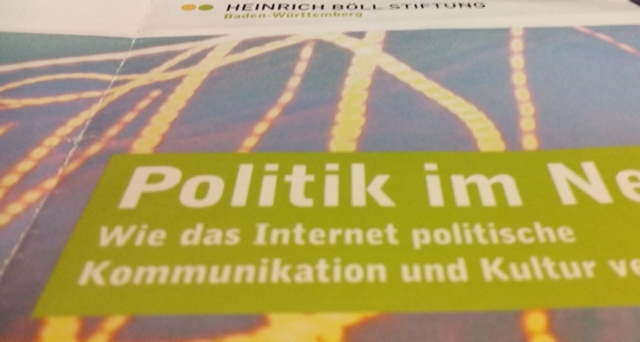Im reizvollen Sigmaringen startete heute der Programmprozess der baden-württembergischen Grünen mit dem ersten von vier Zukunftsforen. Zum Auftakt skizzierte im öffentlichen Teil Ministerpräsident Winfried Kretschmann Erfolge und zukünftige Herausforderungen grüner Politik im Ländle. Danach bestand die Möglichkeit für die Bevölkerung, mit MinisterInnen und Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Der Bildungstisch war dabei – wie immer bei solchen Gelegenheiten – stark umlagert. Auch das ist Politik des Gehörtwerdens.
Im reizvollen Sigmaringen startete heute der Programmprozess der baden-württembergischen Grünen mit dem ersten von vier Zukunftsforen. Zum Auftakt skizzierte im öffentlichen Teil Ministerpräsident Winfried Kretschmann Erfolge und zukünftige Herausforderungen grüner Politik im Ländle. Danach bestand die Möglichkeit für die Bevölkerung, mit MinisterInnen und Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Der Bildungstisch war dabei – wie immer bei solchen Gelegenheiten – stark umlagert. Auch das ist Politik des Gehörtwerdens.
Nach der Mittagspause (vegan oder vegetarisch, ganz nach Wahl) ging’s dann parteiintern weiter mit Foren (bei mir: zum einen Bildung, zum anderen Hochschule – da durfte ich auch einen Input geben), in denen Ideen für das Wahlprogramm gesammelt und in sehr konstruktiver Weise diskutiert wurden. Wer denkt, nach vier Jahren grün-rot und einem zu großen Teilen erledigtem Koalitionsvertrag sei alles getan, was zu tun ist, täuschte sich: „5 Jahre mehr Zukunft“, wie es auf dem Veranstaltungsbutton hieß, würden Baden-Württemberg durchaus gut tun. Es gibt vieles, was angestoßen wurde, aber noch nicht zu Ende geführt ist, und es gibt – gerade, wenn die gefragt werden, die sich nicht Tag für Tag mit der Umsetzung von Gesetzentwürfen und Verordnungen befassen – viele, viele Ideen dafür, wo ein Kabinett Kretschmann II noch ganz neue Dinge anpacken könnte.
Wenn auch die anderen drei Zukunftsforen so verlaufen, dann bin ich guten Mutes, dass wir mit einem Programm in die Landtagswahl gehen können, das nicht nur (berechtigtes) Lob für das seit 2011 Erreichte enthält, sondern bunt und vielfältig gerade auch im Hinblick auf zukünftige Projekte und Herausforderungen sein wird, die darauf aufbauen können. Five more years!