Vorbemerkung: ich habe diesen Text größtenteils bereits im April geschrieben – inzwischen hat sich das Verhältnis zwischen Musk und Trump deutlich verändert. Die Aussagen unten scheinen mir aber weiterhin Gültigkeit zu behalten …
Wie politisch sind Science Fiction und Fantasy? Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben diese Frage ganz unterschiedlich beantwortet. Es gibt Werke, die mit einer politischen Agenda geschrieben wurden. Manchmal ist das sehr sichtbar, etwa wenn Dystopien als Warnung geschrieben werden (Margret Atwoods Handmaid’s Tale, um ein sehr aktuelles Beispiel zu nennen). Oder wenn Utopien zeigen, dass es auch anders gehen kann – einige der Romane von Ursula K. Le Guin oder Kim Stanley Robinson etwa; wer möchte kann hier auch Star Trek einreihen.1 Daneben gibt es Autorinnen und Autoren, die eine politische Agenda haben, die aber weniger klar zu benennen ist – ein humanistischer Grundton bei John Scalzi, eine libertäre Färbung bei Robert Heinlein, konservative Einsprengsel bei Isaac Asimov. Und schließlich gibt es Werke, die eigentlich Manifeste sind – Atlas Shrugged von Ayn Rand auf der rechten Seite, das eine oder andere Solarpunk-Buch und viele der Werke von Cory Doctorow im progressiveren Spektrum fallen mir hier ein.
Wechselwirkungen zwischen Science Fiction und Gesellschaft
Hinter dieser Frage steckt die Idee, dass es eine Wechselwirkung zwischen SF und unserer Gesellschaft gibt. Dass die Auseinandersetzungen und großen Fragen des jeweiligen Zeitgeists sich in SF- (und Fantasy-)Werken wiederfinden, verwundert nicht. Stärker als anderen Genres ist Science Fiction mit der Erwartung verbunden, dass umgekehrt auch das Genre Einfluss auf die Gesellschaft nimmt.2
Am offensichtlichsten ist das beim Blick auf Technologien. Arthur C. Clarke hat den Satelliten erfunden, William Gibson den Cyberspace, und John Brunner Internetviren – so jedenfalls die populäre Sicht der Dinge. Und natürlich lesen Ingenieurinnen und Ingenieure Science Fiction und lassen sich davon beeinflussen. Im Detail ist es etwas komplizierter. Dass es hier eine Wechselwirkung gibt, erscheint jedoch mindestens plausibel.3
Wie sieht es nun mit politischen Ideen aus? Nimmt Science Fiction einen Einfluss auf die Politik, auf das gesellschaftliche Zusammenleben?
Stärker noch als beim Blick auf Technologien rückt nun der Leser oder die Leserin ins Blickfeld. Denn wie ein Werk gelesen wird, was wahrgenommen und was gefiltert wird – das hat nicht nur mit der Intention des Autors oder der Autorin zu tun, sondern eben auch damit, wer es aus was für einer Vorprägung heraus wie liest.
So dürfte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder der bekannteste Star-Trek-Fan in der deutschen Politik sein. Sieht er Star Trek als Utopie einer postkapitalistischen Gesellschaft, oder sind es eher die Abenteuer im Weltraum, taktische Überlegungen und Phaser-Handgemenge, die ihn begeistern? Auch wenn er sich meines Wissen nicht dazu geäußert hat, scheint er eher Captain Kirk als Captain Picard zum Vorbild zu haben.4 Gleichzeitig lässt sich Söders Politik eine gewisse Technikbegeisterung nicht absprechen – von der bayerischen Raumfahrt-Initiative „Bavaria One“ bis zur etwas großspurigen Forderung, der erste Fusionsreaktor weltweit müsse in Deutschland – lies: in Bayern – entstehen, findet sich da einiges. Vielleicht ist das Star Trek zu verdanken.
„Lesarten von Science Fiction: Die dunkle Seite der Macht“ weiterlesen

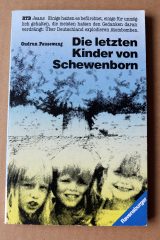
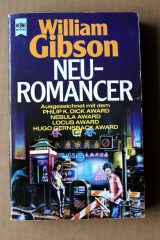
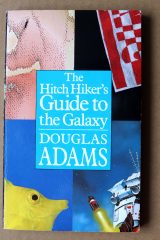

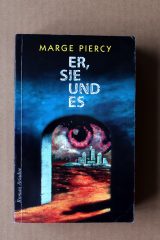
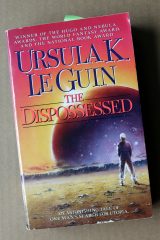
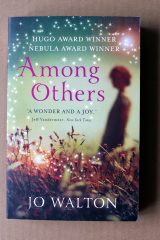
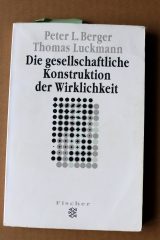
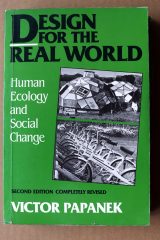
 Aka ist eine Welt, die nur aus einem Kontinent besteht. Vor etwa siebzig Jahren gab es den ersten Kontakt zur Hainish-Ekumene, und in diesen siebzig Jahren hat sich Aka zu einem Musterbeispiel eines Corporate-State entwickelt, in dem Bürokratie, Gewalt, Konsum und ein unermüdlicher Fortschrittsglaube den Alltag bestimmen. Die Kehrseite davon war eine Art Kulturrevolution – die alte ideographische Sprache ist verboten, die alten Dialekte sind verboten, die alten Bücher sind verboten und werden verbrannt. Und die Maz, die Erzählenden, werden verfolgt und umerzogen.
Aka ist eine Welt, die nur aus einem Kontinent besteht. Vor etwa siebzig Jahren gab es den ersten Kontakt zur Hainish-Ekumene, und in diesen siebzig Jahren hat sich Aka zu einem Musterbeispiel eines Corporate-State entwickelt, in dem Bürokratie, Gewalt, Konsum und ein unermüdlicher Fortschrittsglaube den Alltag bestimmen. Die Kehrseite davon war eine Art Kulturrevolution – die alte ideographische Sprache ist verboten, die alten Dialekte sind verboten, die alten Bücher sind verboten und werden verbrannt. Und die Maz, die Erzählenden, werden verfolgt und umerzogen. Ein SF-Roman von Ursula K. LeGuin, der im Hainish-Universum spielt. Es handelt sich dabei um den Bericht des »Erstkontakters« Gently Ai (ein Terraner), der versucht, den Planeten Winter/Gethen in die Ekumene einzubinden. Winter ist ein Planet in der Eiszeit, auf dem es zwar Technologien wie Radio, Motoren, etc. gibt, der aber keine industrielle Revolution erlebt hat. Außerdem gibt es keine Männer oder Frauen – die BewohnerInnen(?) sind geschlechtslos, bis auf eine kurze Phase jeden Monat, in dem sie je nach Zufall, Partner etc. männlich oder weiblich werden (Kemmer) und Sex haben können.
Ein SF-Roman von Ursula K. LeGuin, der im Hainish-Universum spielt. Es handelt sich dabei um den Bericht des »Erstkontakters« Gently Ai (ein Terraner), der versucht, den Planeten Winter/Gethen in die Ekumene einzubinden. Winter ist ein Planet in der Eiszeit, auf dem es zwar Technologien wie Radio, Motoren, etc. gibt, der aber keine industrielle Revolution erlebt hat. Außerdem gibt es keine Männer oder Frauen – die BewohnerInnen(?) sind geschlechtslos, bis auf eine kurze Phase jeden Monat, in dem sie je nach Zufall, Partner etc. männlich oder weiblich werden (Kemmer) und Sex haben können.