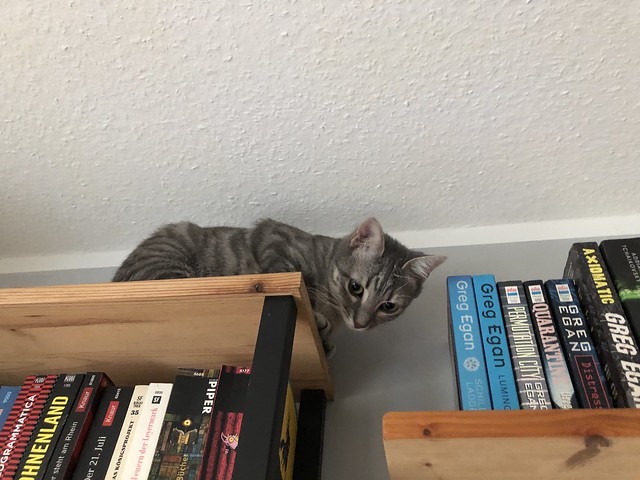Der Sommer ist zwar noch nicht zu Ende – hier in Baden-Württemberg haben die Sommerferien gerade erst vor ein paar Tagen angefangen – aber dennoch haben sich bereits eine ganze Reihe von gelesenen und angeschauten Werken der SF angesammelt, auf die ich gerne hinweisen möchte.
Audiovisuell: ich höre ja keine Podcasts, habe aber festgestellt, dass es im SF-Fan-Bereich einiges gibt (Geek’s Guide to the Galaxy, Retro Rocket, …) – mal sehen, vielleicht wird da doch noch das eine oder andere regelmäßig gehörte Format daraus. Wobei ich auch immer wieder feststelle, dass das typische Podcast-Format „Zwei Leute reden“ nicht unbedingt meins ist. Eine Person, die mit wenig drumherum – und ohne Radiofeatureperfektion – etwas erzählt, gefällt mir meist besser. Falls da irgendwer Empfehlungen im SF-Bereich hat, gerne her damit.
Noch ein Aboservice, Apple TV, dann läuft’s noch nicht mal auf dem großen Bildschirm. Trotzdem hat mir die Serie For All Mankind (2019 ff.) bis dato gut gefallen; ich bin jetzt etwa bei der Hälfte der 2. Staffel. Die erste Staffel erinnerte da und dort stark an Mary Robinette Kowal Lady-Astronaut-Reihe. Wir starten in den 1960ern, im Unterschied zur realen Geschichte setzen hier die Sowjets den ersten Fuß auf den Mond. Daraus entwickelt sich ein space race, dass viel mächtiger wird, als es in unserer Welt je war, mit Mondbasis und Plänen für den Mars. Dieses Rennen um die „Eroberung“ des Weltalls – als harte, realistische SF gezeigt – bietet jedoch nur den Hintergrund für die Lebensgeschichten von fünf, sechs oder sieben Personen/Familien mit allen Dysfunktionalitäten und Problemen. Neben einem Hauch Dallas/Denver Clan kommt viel Politik und Zeitgeschichte vor – Emanzipation, Rassismus, eine aus begründeter Angst nur im verborgenen stattfindende lesbische Liebesgeschichte usw. Die erste Staffel spielt in den späten 1960ern/frühen 1970ern vor dem Hintergrund des Vietnam-Kriegs, die zweite dann Mitte/Ende der 1980er Jahre, mit einer entsprechend angepassten Ästhetik und – dank einer guten Maske – realistisch gealterten Figuren sowie nach und nach immer mehr Abweichungen von unserer Zeitlinie (klar, dass der Fokus auf den Weltraum auch in andere Bereiche ausstrahlt).
Ganz anders die SF-Komödie BigBug (2022) – ein Film von Jean-Pierre Jeunet, der mit Die fabelhafte Welt der Amélie bekannt wurde. Statt in eine verklärte französische Vergangenheit geht es hier in eine absurd überdrehte Zukunft, in der Roboter und Androide für die durchgestylte Kleinfamilie mindestens so wichtig sind wie fliegende Autos und vollautomatisierte Einfamilienhäuschen. Wer eine ernsthafte Auseinandersetzung mit KI oder ähnlichem erwartet, ist hier fehl am Platz; wer sich auf bunte Kostüme, absurde Charaktere und einen immer wilder werdenden Plot einlassen kann, wird sich vergnügen.
Wieder gelesen habe ich Samuel Delanys Babel 17 (1966), nachdem ich zufällig – auf Twitter, wo auch sonst – auf eine Rezension von Jo Walton aus dem Jahr 2009 gestoßen bin, in der sie hervorhebt, wie modern dieser Roman ist – mit einer weiblichen Hauptperson, einem gegen die Gewohnheiten der Military SF realistisch gezeichneten Krieg zwischen zwei Mächten, vielen Ideen über den Zusammenhang zwischen Sprache, Erkenntnis und Programmierung, linguistischen Experimenten, Dreier-Liebesbeziehungen als ein standardmäßig notwendiger Bestandteil von Raumschiffbesatzungen und dergleichen mehr. Für heutige Verhältnisse ein dünnes, schnell gelesenes Buch, das völlig zu recht weiter erhältlich ist. Und ein Anlass, über die Pendelbewegung der Geschichte und nie endende Kämpfe um gesellschaftlichen Fortschritt nachzudenken.
Ebenfalls leider nur ein dünnes Buch, aber dafür sehr gegenwärtig, ist Becky Chambers A Prayer for the Crown-Shy (2022). Der Titel bedarf vielleicht einer Erläuterung – kronenscheu bezieht sich hier auf die Bäume, die nebeneinander wachsen, sich aber nie berühren. Das Buch ist der zweite Band ihrer Monk-and-Robot-Reihe. Während im ersten Teil Dex in die Wildnis gegangen ist und dort dem Roboter Mosscap begegnete – einem Überbleibsel einer vergessenen industriellen Zeit dieser postindustriellen Zivilisation -, geht es nun den anderen Weg: Dex wird zu Mosscaps Reiseleiter*in/Weggefährt*in/Anthropolog*in auf dem Weg durch Panga. Dieser Kunstgriff im Sinne Garfinkels ermöglicht es Chambers, uns zu zeigen, wie Panga – vielleicht eine Utopie? – funktioniert und wie die Menschen hier in Gemeinschaften leben. Viel passiert in diesem Buch nicht. Dex und Mosscap reisen durch einige Orte, reden miteinander, philosophieren. Und trotzdem oder genau deswegen ist dieses entspannte Buch genau das richtige für unsere sehr gegenteilige Zeit.
Thematisch ein bisschen ähnlich – aber viel actionreicher – ist Osmo Unknown and the Eightpenny Woods (2022) von Catherynne Valente, ein sehr schön geschriebenes Jugendbuch. Die Reisegruppe besteht hier aus dem Teenager Osmo Unknown aus einem weltabgeschiedenen Dorf sowie aus einem unhöflichen Dachs und dem menschenscheuen Pangolin-Mädchen Never aus dem Wald. Nach einem schrecklichen Ereignis müssen die drei die Unterwelt der Eightpenny Woods finden – und am Schluss herausfinden, was es mit der Hochzeit von Wald und Tal auf sich hat. Stilistisch ähnelt das Buch den Fairyland-Büchern von Valente mit surrealen Elementen, die in der Logik der Geschichte aber vollkommen notwendig sind. Mit A Prayer for the Crown-Shy hat die Entstehungsgeschichte, während der Pandemie geschrieben worden zu sein, gemeinsam – und vielleicht deswegen den utopischen Unterton, die Frage nach dem Glauben an eine solidarische Menschheit.
Last Exit (2022) von Max Gladstone ist auf den ersten Blick eine typische amerikanische Fantasy-Road-Saga im Stil von American Gods, auch wenn die Straße hier und dort durch düstere Schreckenswelten statt durch Wüsten und Canyons führt. Auf den zweiten Blick geht es darum, wie Menschen damit leben können, zu entdecken, dass aus mathematisch-magischen Parallelwelten die Apokalypse droht, und beim Versuch, etwas dagegen zu unternehmen – noch auf der Uni -, zunächst einmal scheitern. Die Geschichte spielt einige Jahre später, als Zelda Qiang ihre damaligen Freund*innen aus den inzwischen etablierten Lebenswelten reißt, um es ein zweites Mal zu versuchen. Nebenbei ist Last Exit eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Geschichte über Verrat, und eine Geschichte darüber, wie es ist, drohendes Unheil lieber zu ignorieren. Da ließen sich dann Parallelen zu unserer Zeit multipler Krisen finden.
Etwas ratlos hat mich The City Inside (2022) von Samit Basu zurückgelassen. Das ist eigentlich ein Roman über Social Media, in ein Indien/Delhi etwas in der Zukunft gelegt. Die aufgebaute Welt ist eindrucksvoll – „Reality Producer“ managen das perfektionierte Leben von „Flow“-Stars, während die Luft vor der Tür so heiß und toxisch ist, dass Atemschutzmaske und Kühlpack notwendig sind, um klimatisierte Räume zu verlassen. Unterschiedlichste Realitäten, Kasten, Klassen kreuzen sich. Die Superreichen spielen Intrigen aus, die Regierung ist totalitär, im Untergrund gibt es einen semi-kriminellen Widerstand. Und mit Joey haben wir eine spannungsreiche und lebendige Hauptperson. Trotzdem passt das alles am Schluss nicht zusammen, das Buch bricht abrupt ab, ohne zu einer Auflösung zu kommen, und auch die „deleted scenes“ – ist es das Kapitel 10, oder sind es tatsächlich deleted scenes – helfen nicht wirklich weiter. Das hätte mehr sein können.
Ebenfalls irritierend, aber doch eher positiv irritierend, fand ich Dark Factory (2022) von Kathe Koja. In einem Satz würde ich sagen: eine schwule Liebesgeschichte in der durch ubiquitäre virtuelle Realität noch einmal ganz anders gewordenen urbanen DJ- und Club-Szene der Zukunft gekreuzt mit einem Hauch magischem Realismus. Interessante Hauptpersonen. Und ein sehr eigener Schreibstil mit Szenenwechseln mitten im Satz, einigen Neologismen, die nicht erklärt werden (wie überhaupt hier nichts erklärt wird), ein dem Gegenstand angemessenes Tempo. Nett: in dieser Zukunft scheint deutsche Kultur gerade hip zu sein, zumindest bei der Benennung von Cafes, Clubs und Blumenläden in beispielsweise London.