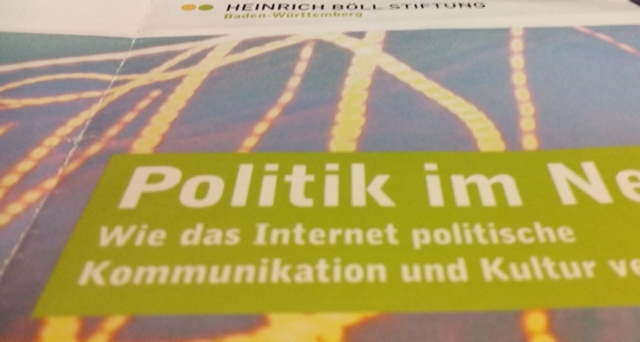Immerhin das Moos leuchtet grellgrün, und manche Wiese tut das auch. Ich war dieses Wochenende grün unterwegs ‑in Hamburg tagte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaft, Hochschule, Technologiepolitik (u.a. zum Austausch mit der Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, zur Debatte über den Imboden-Bericht zur Exzellenzinitiative, und zu einer ersten Ideenfindung für das Bundestagswahlprogramm 2017). Und dann ging’s mit einer kleinen Delegation von Hamburg nach Berlin, wir besuchten die BAG Energie, um über Fusionsforschung zu diskutieren. Was durchaus kontrovers, alles in allem aber erfreulich sachlich und niveauvoll stattfand. Und dann im Nachtzug wieder nach Freiburg zurück. Erholsam ist das nicht wirklich.
Ökologische Verelendungstheorie
In dieser Woche findet der „Earth Overshoot Day“ statt – also der Tag, an dem der Ressourcenverbrauch des Jahres das nachhaltig nutzbare Ressourcenbudget des Jahres überschreitet. Idealerweise sollte er frühestens auf dem 31. Dezember liegen, statt dessen wächst der Ressourcenverbrauch, so dass er im Herbst und inzwischen deutlich im Sommer liegt. Jahr für Jahr rückt das Datum des Earth Overshoot Days nach vorne. So weit die Fakten.
Was mich umtreibt, ist etwas, was sich – je nach Laune – als „TINA-Paradigma“ der Ökoszene oder als „ökologische Verelendungstheorie“ beschreiben ließe.
TINA, „There is no alternative“ stammt wohl von der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher, aber auch Bundeskanzlerin Merkel agiert gerne „alternativlos“. In beiden Fällen ist damit gemeint, dass die jeweilige (neoliberale) Politik den einzigen überhaupt denkbaren Weg darstellt. Angesichts der ökologischen Fakten liegt es nahe, TINA zu übernehmen: Die Welt muss ökologischer und nachhaltiger werden, oder sie wird untergehen. Klingt nach einer einfachen Wahrheit, ist aber letztlich doch komplizierter – denn TINA könnte auch „There is no automatism“ heißen.
Das heißt: Aus den ökologischen Fakten folgt noch lange keine politische Einsicht, denn dieser Willensbildungsprozess findet nach wie vor in der politischen Arena statt, in der unterschiedliche Interessen, Weltsichten und „Sachzwänge“ aufeinander prallen. Fakten im Sinne außersozialer Tatsachen spielen bei der Meinungsbildung eine Rolle (Kretschmann: „Gegen Zahlen lässt sich nicht anbrüllen!“) – aber sie sind eben nicht der einzige Faktor. Was als wahr gilt, was wie interpretiert wird, was gesehen und was ausgeblendet wird, welcher Weg in Richtung Nachhaltigkeit als tauglich angesehen wird, und welcher nicht – hier haben wir es mit sozialen Tatsachen zu tun, die sich eben nicht automatisch aus den schlichten Ressourcenverbrauchszahlen und deren Extrapolation ergeben. Politik braucht weiterhin überzeugende Akteure und Akteurinnen.
Wenn ökologische Politik alternativlos ist, dann heißt das also noch lange nicht, dass nicht hart daran gearbeitet werden muss, diese Alternative auch tatsächlich zur im Diskurs dominanten politischen Option zu machen. Und sie dann auch noch umzusetzen.
Wenn TINA der Leitstern der harten Neoliberalen ist, dann ist die Verelendungstheorie der Hoffnungsträger einer bestimmten Sorte von MarxistInnen. Zugespitzt und popularisiert: der Kapitalismus wird letztlich durch eine zunehmende Verschlechterung der Lebensbedingungen der ArbeiterInnen schon selbst dafür sorgen, dass es zur großen Revolution und zum Umschwung der Verhältnisse kommt. So etwas in der Art gibt es auch in grün – wenn Peak Oil überschritten ist, wenn die Böden ausgelaugt sind, wenn die Nahrungsmittelversorgung zusammengebrochen ist – spätestens dann, mit der großen Krise, wird der große Umschwung zu nachhaltigen und ökologischen Produktions- und Lebensweisen kommen. Weil’s halt einfach gar nicht anders geht, und dann jeder und jede die ökologische Wahrheit sehen wird.
Mal abgesehen davon, dass bei der Hoffnung auf Verelendung immer auch Zynismus mitschwingt, halte ich die eine wie die andere Variante dieser Vorstellung für falsch. Auch hier sind die Verhältnisse komplizierter, auch hier scheint es mir keine Automatismen zu geben. Allein schon deswegen, weil die weltweiten Chancen und ökologischen Abhängigkeiten so ungleich verteilt sind bzw. als ungleiche Verteilung geschaffen und aufrecht erhalten wurden und werden. Zudem bleiben Innovationskraft und gegenläufige Tendenzen unterbelichtet.
Unterm Strich bleibt die Aussage, dass es dumm wäre, ökologische Politik auf die Hoffnung auf Automatismen aufzubauen. Es bleibt die Notwendigkeit – und das ist Arbeit – sich in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Arenen weiterhin selbst darum zu kümmern, dass es in Richtung Nachhaltigkeit geht. Darauf, dass sich hier bereits einiges bewegt, dass es durchaus auch positive Nachrichten gibt, Hoffnungen zu setzen, erscheint mir weitaus sinnvoller, als es die mentale Vorbereitung auf den „unausweichlichen“ ökologischen Kollaps wäre.
Warum blogge ich das? Weil es manchmal hilfreich ist, sich die Begrenzungen der politischen Wirksamkeit außersozialer Fakten vor Augen zu führen. Selbst psychologisch lässt sich ganz gut erklären, warum es manchmal einfacher ist, kontrafaktisch auf z.B. einer unbedingten Wachstumsorientierung zu beharren, als die Grenzen des Wachstums zur (politischen) Kenntnis zu nehmen.
Kurz: Vox populi im IC
Im Zug von Stuttgart nach Freiburg nolens volens zwei bildungsbürgerlichen Paaren im Rentenalter zugehört. Zu allem eine gut gebildete Meinung, Einigkeit zählt mehr als Fakten. Waren im Museum, Herbert hat das ja gut organisiert mit der Bahnfahrt. „Grün-Rot redet mit Beamten“, so die Schlagzeile. Der Chor: unerhört, die Beamten zu benachteiligen, Bayern überträgt die Tariferhöhung ja auch zeitgleich. Der Schmid kann’s halt nicht. Schwenk zur Stadtpolitik, Rieselfelder Naturschutzgebiet soll nicht bebaut werden. Der Chor: Unerhört, wenigstens prüfen müsse man, sind ja Fachleute, die Stadtplanungsrentner, einfach aufheben, grüne Wiesen gibt es ja auch anderswo. Die Stadtbau baut hässliche Reihenhäuser, kriegt sie nicht verkauft, 700.000, kein Wunder, kann halt nicht rechnen, die Stadtbau. Der Zug hält fahrplanmäßig in Lahr, der Chor: Da hält der sonst nie, sicher ein Sonderstopp der Deutschen Bundesbahn für einen Bundestagsabgeordneten, genau. Und iih, die Läuse kommen wieder, fast wie 1946 ist es jetzt in den Schulen.
Die beiden grauen Paare amüsieren sich prächtig mit ihrer vertrauten und beschwingten Besserwisserei. Zur Not wird die Wikipedia zitiert. Wichtig ist nur, Recht zu behalten. Weil: alle anderen haben ja keine Ahnung, und böser Wille steckt eh dahinter …
Gefreut haben die vier sich dann, dass sie trotz Verspätung noch die Anstalt angucken können. Finanziert aus „Zwangsgebühren“. Auch wenn die früher besser war. (Und ich frage mich, was die wohl wählen …)
Politik im Netz – was geht?
Letzten Samstag fand die Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg statt, die diese freundlicherweise dem Thema „Politik im Netz – Wie das Internet politische Kommunikation und Kultur verändert“ gewidmet hatte. Im Folgenden also ein paar Streiflichter aus der Konferenz. Das Publikum wirkte übrigens sehr viel weniger nerdig, als das Thema es hätte vermuten lassen.
Kurz: Moral sorgt für Ärger
Einen Gedanken, den Peter Unfried von der taz beim grünen Freiheitskongress aufgeworfen hat, möchte ich hier doch noch einmal aufgreifen: Die fehlende Überzeugungskraft des grünen Projekts sei auf einen Überschuss an Moral zurückzuführen, und zwar extern uns Grünen zugesprochener Moral. Statt auf Moral sei auf Kulturwandel zu setzen, wenn es drum gehe, ökologische Gedanken politisch anschlussfähig zu machen. Solange dagegen – so würde ich das ausdrücken – im Code von Moral/Unmoral kommuniziert werde, werden falsche Rahmungen aufgerufen und falsche Erwartungen geweckt. Solange wir den Eindruck erwecken, Menschen bekehren zu wollen, produzieren wir Widerstände. Gleichzeitig kann dann ganz einfach jedes „grüne Fehlverhalten“ zum Siehste-Beispiel umgewidmet werden. Da muss gar nicht auf das Beispiel Veggieday zurückgegriffen werden; auch das alltägliche Verkehrsverhalten ist für diesen bewussten moralischen Fehlschluss anfällig: Ha, der Minister ist gar nicht Rad gefahren? Oho, die grüne Abgeordnete ist geflogen – dabei wollt ihr doch …!
Jetzt ließe sich leicht argumentieren, dass das ja gar nicht so sei. Wir wollen ja niemand umerziehen. Jedenfalls beteuern wir das ständig. Das fiese hier ist aber gerade, dass es überhaupt nicht darum geht, was wir Grüne sagen (wollen), sondern darum, wie andere das, was wir sagen, deuten und wahrnehmen. Der Text von spektrallinie dazu, dass wir’s besser wissen, passt an dieser Stelle ganz gut … und vermutlich würde sich auch eine Re-Lektüre von Luhmanns Ökologischer Kommunikation aus den 1980er Jahren lohnen, auch da ging es, wenn ich mich richtig erinnere, schon um dieses Problem.
Tja, und was lernen wir jetzt daraus, was ist die Moral von der Geschichte? Können wir für ein gutes Leben streiten, ohne dass das moralisch gelesen wird? Ist grüne Politik, die auf „du sollst“-Aussagen verzichtet, überhaupt noch glaubwürdig? Oder werden wir gerade dann stark, wenn wir uns von den immer wieder angeführten persönlichen Konsummustern und Lebensstilen lösen, und statt dessen bewusst politisch argumentieren? Soll heißen: Wir haben das Ziel, die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Ob Menschen sich individuell dafür entscheiden, Fleisch zu essen oder nicht, ist uns egal – das ist keine politische Frage. Politisch wären dagegen die Fragen, ob Massentierhaltung unterstützt wird oder nicht (also im Sinne von Subventionen und auch von Ordnungspolitik), ob Radexpresswege gebaut werden oder nicht, und welche Grenzwerte für Automobile gelten sollen. Ob eine solche Herangehensweise gelingen kann (die ja durchaus auch den grünen „Markenkern“ berührt), erscheint mir derzeit noch offen zu sein. Böse ausgelegt werden kann alles. Aber zumindest da, wo wir selbst das Heft der Kommunikation in der Hand haben, scheint es mir sehr sinnvoll zu sein, immer wieder zu testen, ob wir – als Partei! – gerade über Politik oder über Moral sprechen.