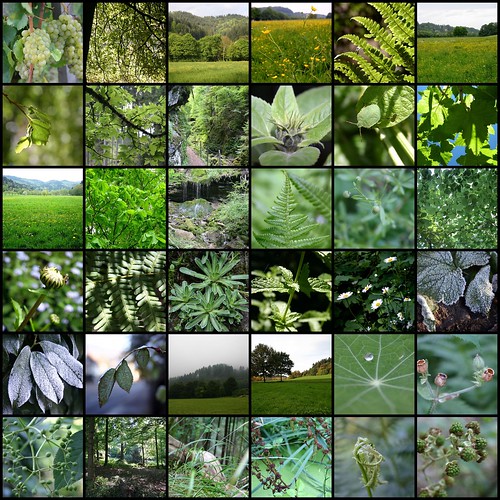Die amerikanische National Geographic Society hat vor kurzem das Ergebnis eines 14-Länder-Vergleichs vorgestellt, den Greendex. Dabei geht es um den Beitrag von a. Konsumentscheidungen und b. Kontextbedingungen für den Konsum in unterschiedlichen Ländern zu einem nachhaltigen Lebensstil, wohl vor allem an den CO2-Emissionen festgemacht.
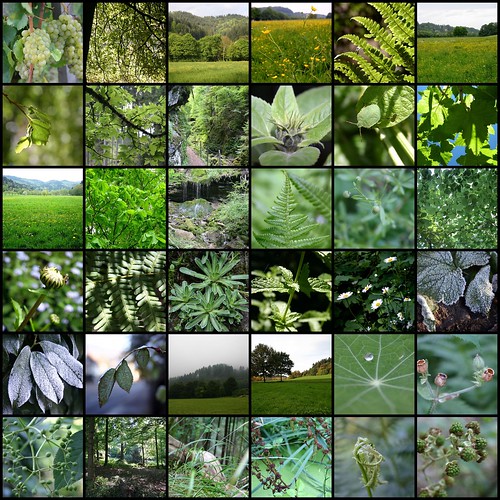
Wie grün bist Du?
Befragt wurden 14.000 Haushalte in den 14 Ländern mit einem 65 Variablen umfassenden Survey, die dann zum „Greendex“ – einem Punktewert – zusammengefasst wurden. Etwa 60 % der Fragen beziehen sich dabei auf Konsumentscheidungen, also Bereiche, in denen unterschiedliches Verhalten möglich ist. Prinzipiell sind solche Untersuchungen nichts neues, auch die Umweltbewusstseinsbefragungen des Umweltbundesamtes gehen in diese Richtung, interessant ist hier vor allem der Ländervergleich.
Dabei kommt – bezogen auf das Verbraucherverhalten in den einzelnen Ländern – folgende Reihenfolge heraus:
1. Brasilien, Indien (je 60 Punkte)
2. China (56,1 Punkte)
3. Mexiko (54,3 Punkte)
4. Ungarn (53,2 Punkte)
5. Russland (52,4 Punkte)
6. Großbritannien, Deutschland, Australien (je 50,2 Punkte)
7. Spanien (50,0 Punkte)
8. Japan (49,1 Punkte)
9. Frankreich (48,7 Punkte)
10. Kanada (48,5 Punkte)
11. USA (44,9 Punkte)
Die niedrigen Punktzahlen der Schwellenländer sind mit einem geringeren materiellen Wohlstand verbunden (Zahl der Autos, Wohnungsgröße), zum Teil wohl auch vom Klima abhängig (Heizungsbedarf etc.). Dass die USA ganz hinten liegen, ist nicht besonders erstaunlich – erstaunlich ist aber der große Abstand zu den übrigen Ländern.
Deutschland liegt insgesamt im Mittelfeld, bezogen auf die Industrieländer relativ weit vorne. Das mag etwas damit zu tun haben, dass „umweltfreundliches Verhalten“ hierzulande schon ziemlich lange thematisiert wird (vgl. Telepolis-Artikel).
Auf der Website Greendex lässt sich – wie inzwischen auf vielen anderen Seiten ähnliche Fußabdrücke etc. zu finden sind – auch der persönliche „Greendex“ berechnen.
Bis auf die Frage 9, die so nur Sinn macht, wenn die entsprechenden Geräte vorhanden sind, sieht der Fragebogen für die Berechnung erst einmal ganz vernünftig aus. Bei mir kommt ein Score von 61 heraus, was mich freut, aber nicht besonders überrascht (kein Auto, relativ viel Regionales und Recycling, Niedrigenergiemietswohnung).
Eine Information habe ich auf der Seite bisher nicht gefunden: welcher Score wäre tatsächlich nachhaltig? Bei ähnlichen Rechnern zum „Fußabdruck“ kommt dann ja meist heraus, dass beim persönlichen Lebensstil weltweit zwei bis drei Planeten notwendig wären (bei mir: 1,6) – diese Information scheint mir hier zu fehlen.
Warum blogge ich das? Weil’s mich wissenschaftlich und politisch interessiert und hier globale Daten mit einem persönlichen Kalkulator verbunden werden, was ich interessant finde.
 Seit ein paar Wochen ist die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) nun mit einer neugestalteten Website im Netz. Daran lässt sich viel kritisieren – etwa die fehlende Verwendung von Social Software, der Bleiwüstencharakter oder, da würde ich inzwischen zustimmen, der fehlende RSS-Feed für die einzelnen Rubriken –, immerhin scheint die Seite sich aber tatsächlich inhaltlich zu füllen, mit Pressemitteilungen, Meldungen, Stellenangeboten, Hinweisen auf Call for Papers und dergleichen mehr. Ein paar Baustellen gibt es noch, so sind die Sektionsseiten vielfach noch komplett leer, aber mit etwas Glück (und doch ein bißchen Web 2.0?) wird daraus was.
Seit ein paar Wochen ist die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) nun mit einer neugestalteten Website im Netz. Daran lässt sich viel kritisieren – etwa die fehlende Verwendung von Social Software, der Bleiwüstencharakter oder, da würde ich inzwischen zustimmen, der fehlende RSS-Feed für die einzelnen Rubriken –, immerhin scheint die Seite sich aber tatsächlich inhaltlich zu füllen, mit Pressemitteilungen, Meldungen, Stellenangeboten, Hinweisen auf Call for Papers und dergleichen mehr. Ein paar Baustellen gibt es noch, so sind die Sektionsseiten vielfach noch komplett leer, aber mit etwas Glück (und doch ein bißchen Web 2.0?) wird daraus was.