Gestern hatten die Grünen eine Podiumsdiskussion zu den in Freiburg doch heftig umstrittenen Alkoholverboten. Ich selbst konnte umzugsvorbereitungsbedingt leider nicht hin, laut BZ war die Veranstaltung mit 100 Leuten gut besucht. Kontrovers genug dazu war sie ohne Zweifel. Eine ausführliche Einschätzung gibt es bei Thorsten – der nicht mit vorsichtiger Kritik an der grünen Fraktion spart.
Kurzeintrag: Grüne & Autos
Ich kenne mich – führerscheinlos und so – mit Autos ja noch weniger aus als Alex, finde es aber ganz lustig, wenn Grüne jetzt zu ihren Fahrzeugen interviewt werden. Bei Alex Bonde ist’s ein Prius, und er ist da unter baden-württembergischen Grünen nicht ganz alleine. Auch Boris Palmer und Sylvia Kotting-Uhl haben dieses Fahrzeug gewählt. Solange der politische Einsatz für den öffentlichen Nahverkehr nicht drunter leidet, soll’s mir recht sein.
Kurzeintrag: Hessenwahl
Hessen bleibt spannend, aber aus links-grüner Perspektive stellt sich doch vor allem die Frage, „Wie lange will sich die Sozialdemokratie noch in einer Koalition mit den Christdemokraten quälen, wenn es doch eine Mehrheit für eine progressive Politik gibt?“. Nachdem die FDP offensichtlich nicht regieren will, frage ich mich das auch, und meine: gerade im ja doch grün gesehen sehr realpolitischen Hessen wäre rot-rot-grün ein interessantes Experiment. Von mir aus auch – vgl. Geschichte der Grünen – als Lafontaine-Cohn-Benditsche Duldung.
Lego, Lego, Lego!
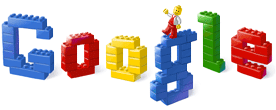
Google feiert das auch …
Genau. Lego wird fünfzig Jahre alt, und ein Blog-Artikel von Joel Johnson bei BoingBoing Gadgets brachte mich dazu, zu realisieren, dass ich tatsächlich das „Galaxy Explorer“-Raumschiff hatte, das er da als erstes abfeiert. Ganz schön lange her. Mein letzter Lego-Kasten ist ein Mindstorm-Set, dass ich mir gegen Ende meines Studiums gekauft habe (Roboter, Informatik usw.). Die ganzen anderen Steine liegen heute irgendwo bei meinen Eltern, wild durcheinander. Und Zora ist noch zu klein dazu.
Angesichts der wichtigen Frage „Playmobil oder Lego“ (ganz klar letzteres) ist es jedoch nie zu früh zur frühkindlichen Markenprägung:

Zora hat zu Weihnachten Duplo bekommen
So ähnlich war das bei mir übrigens auch. Duplo gab es wohl noch nicht, als ich richtig klein war – bei meinen Schwestern dann schon. Aber ich erinnere mich noch gut daran, bei Besuchen meiner Großeltern mit den Legosteinen gespielt zu haben, die meiner Mama und meiner Tante gehörten. Keine Sondersets, sondern schlichte eckige Klötze. Wohl tatsächlich aus den spätern 1950ern, frühen 1960ern (vgl. Zeitlinie).
Beim Weihnachtsgeschenkkaufen ist mir aufgefallen, dass Lego inzwischen unglaublich ausdifferenzierte Sets anbietet (gilt für Duplo wie für die richtigen Steine). Irgendwie ist das schade. Erstens nervt die immer schneller werdende Modellfolge (Johnson schreibt zwischen den Zeilen ähnliches im oben genannten Blogeintrag bei Boing Boing Gadgets), und zweitens ist das tolle an Lego ja gerade, dass alles zusammenpasst, und dass – anders als bei Playmobil – so wenig vorgegeben ist. Für Zora haben wir deswegen auch nicht das Bauernhofset, das Stadtset und erst recht nicht das Kleine-Prinzessin-Set gekauft, sondern ziemlich schlichte Grundbausteine. Und, wie auf dem Foto nicht zu sehen ist (aber hier), Hund und Katze aus Nicht-Lego.
Warum blogge ich das? Nostalgie siegt über Plastik. Mehr zum Thema Playmobil gibt’s übrigens in der Magisterarbeit von Christian Haug.

