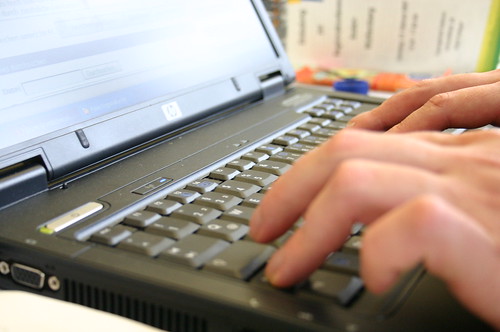In den letzten Jahrzehnten gab es für Wahlkämpfe zwei Hauptspielfelder: die Arena der bundesweiten Massenmedien – vom Talkshowauftritt bis zum Bericht über den Parteitag – auf der einen Seite, und die Straße mit Plakaten, Infoständen, dem Verteilen von Flyern und Hausbesuchen auf der anderen Seite. Irgendwo dazwischen dann noch „Hinterzimmerveranstaltungen“ (also die üblichen Podiumsdiskussionen und Referate) und neue Aktivitätsformen wie Vorwahlpartys.
Allmählich entdecken die Parteien (nicht zuletzt angesichts der Kampagnen von Howard Dean 2004 und Barack Obama 2008), dass mit dem Web 2.0 die Möglichkeit eröffnet wurde, einen neuen Raum für Interaktionen zwischen Parteien und Öffentlichkeit zu nutzen. Im Sinn von „Visitenkarten“ oder „Schaufenstern“, ja selbst von „virtuellen Parteizentralen“ (C. Bieber) ist diese Entdeckung schon ein paar Jahre alt und inzwischen recht gut etabliert (R. Kuhlen spricht von der jetzt auch schon zehn Jahre zurückliegenden Bundestagswahl 1998 als „Mondlandung des Internet“). Neu ist die Entdeckung, dass das Internet eben nicht nur die Möglichkeit bietet, Informationen zu senden, Programme und KandidatInnen zu präsentieren, und auch über das Eröffnen von Foren hinausgeht, sondern tatsächlich einen virtuellen Raum darstellt, in dem Menschen sich sowohl aufhalten als auch aktiv sind.
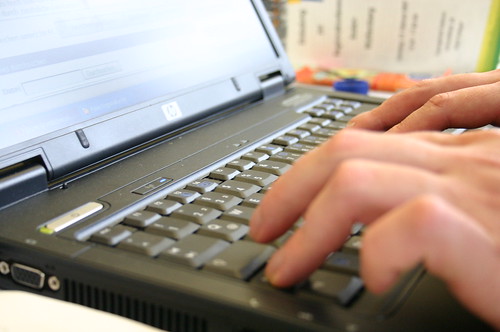
Live-Blogging bei der baden-württembergischen Regionalkonferenz um Grundeinkommen/Grundsicherung
Soweit die Vorbemerkung. Was bedeutet es nun, das „Web 2.0“ für Wahlkämpfe und Parteikommunikation zu nutzen? Naheliegend sind dabei zwei Dinge: zum einen der „user generated content“, also die aktive Beteiligung von Menschen, und zum anderen die soziale Vernetzung über das Internet. Dabei entstehen dann Dinge wie meinespd.net oder my.fdp als große parteipolitische Web 2.0‑Plattformen bzw. Communities, und auf einem kleineren Level parteipolitische Blogs, Podcasts (a la Merkel …) und Wiki-Experimente (pdf).
In diesem Rahmen bewegen sich auch Überlegungen, wie Bündnis 90/Die Grünen, lange Zeit netzpolitische Vorreiter und weiterhin eine Partei mit einer sehr netzaffinen Wählerschaft, besser mit dem Web 2.0 klarkommen können. Es gibt viele Blogs einzelner Leute und Kampagnenblogs zu Klima oder Überwachung, mehr oder weniger alle Abgeordneten haben ihre Websites, auf den Bundes- und Landesverbandsseiten sind häufiger mal Podcasts und interaktive Schnippsel (wie der „Grün-o-mat“) zu finden usw. Ab und zu wird mit diesen oder jenen Elementen des Web‑2.0‑Portfolio experimentiert – diese Experimente (etwa BDK interaktiv oder Wikis für Programmbausteine) verschwinden aber genau so schnell wieder, wie sie gekommen sind. Ein einheitliches Konzept fehlt weitgehend, ist in der sehr auf Autonomie bedachten Struktur der Partei wohl auch schlecht durchsetzbar. Ebenso gibt es bisher nichts in Richtung „mein grün“ für Mitglieder und erst recht nicht für WählerInnen.
2009 stehen nun Europa‑, BaWü-Kommunal- und Bundestagswahl an. Umso drängender wird die Frage, in welche Richtung sich der „green space“ entwickeln soll. Dabei geht es um verschiedene Zielgruppen für die Web‑2.0‑Nutzung der Partei; mir fallen mindestens vier ein:
- Grüne FunktionärInnen bzw. grüne Gliederungen, die einfach und schnell ins Netz wollen (z.B. mit WordPress). Bezogen auf den Kommunalwahlkampf heißt das beispielsweise auch: ungefähr 500 grüne und grün-nahe Listen und etwa zehnmal so viele KandidatInnen könnten im Netz auftauchen. Aber auch außerhalb des Wahlkampfs sollte der virtuelle Infostand nicht eingeklappt werden.
- Grüne Mitglieder und Aktive, die sich mit Gleichgesinnten austauschen und kurzschließen wollen – neben Blogs findet da viel heute in Mailinglisten statt, so ist’s jedenfalls im linken Flügel.
- (Potenzielle) WählerInnen, die mehr wollen, als nur eine Hochglanzwebsite in die Hand gedrückt zu bekommen, wobei das „mehr“ sowohl in Richtung Unterhaltung als auch in Richtung tiefergehende Information/Interaktion gehen kann.
- Bisher politisch schlecht erreichte „Netizens“, die, so die Vermutung einiger, eigentlich viel mit Grün anfangen können müssten, wenn sie doch bloss mal herschauen würden.
Meine Frage an alle ist jetzt schlicht: welche (zielgruppenspezifischen) Bausteine sind notwendig, um – möglichst jenseits der großen Lösung – wirkungsvoll den Infostand 2.0 und mehr im virtuellen „green space“ aufzustellen? Oder anders gesagt: welche Elemente werden (von wem) sehnlichst herbeigewünscht?
Warum blogge ich das? Aus prinzipiellem Interesse, aber auch, weil verschiedene parteiinterne Vernetzungen zu diesem Thema existieren, und ich mit manchen dort vorgeschlagenen „Hype“ und/oder Marketing-Lösungen nicht so viel anfangen kann.
Update: Weil’s so schön passt, hier noch ein Hinweis auf die gerade erschienen Kurzstudie zu Politik im Web 2.0 von newthinking (dabei geht es um die Nutzung der existierenden Web 2.0‑Infrastrukturen durch Parteien und PolitikerInnen).
Update 2: Spreeblick geht ebenfalls auf die newthinking-Studie ein und fragt sich, wer die Web 2.0‑Lücke „schließen wird. Denn im Grunde stellt die Abwesenheit professioneller Politikkommunikation eine Chance dar. Denn wenn sich Menschen vernetzen, entstehen Macht und Einfluss. Auch in Deutschland.“
Update 3: (4.7.2008) Vielleicht noch eine ergänzende Überlegung: möglicherweise sind kleinere, spezialisiertere Web 2.0‑Netzwerke für die Kommunikation und Diskussion politische Botschaften interessanter (oder zumindest ebenso interessant) wie die großen vier oder fünf (Facebook, StudiVZ, XING, …). Mir fallen dabei einerseits thematisch orientierte Plattformen ein, also z.B. utopia.de (siehe auch hier) mit Themenschwerpunkt „nachhaltig leben“ (zu dem Thema gibt’s natürlich auch dutzende kleinere Blogs und Projekte), oder kaioo als „soziales“ social network (mehr bei Henning), aber auch z.B. lokalisierte Communities wie z.B. das BZ-nahe fudder für Freiburg (Stichworte dazu hier) oder stuttgart-blog.net als Vernetzung der lokalen Blog-Szene in Stuttgart. Zu den Aktivitäten lokaler Zeitungen im Netz steht passend heute was bei Spiegel Online. Es gibt sicher noch eine ganze Reihe mehr an lokalen Communities, selbst in Baden-Württemberg. Bisher weniger erfolgreich scheinen mir dagegen Sachen wie meinestadt.de (nur als Beispiel für die Klasse von Plattformen genannt) zu sein, die versuchen, ein globales System für lokale Angebote aufzubauen. Das wächst von unten her IMHO besser.
Update 4: (6.7.2008) In der englischsprachigen Wikipedia gibt es eine lange Liste von „social networking websites“. Scheint mir ganz hilfreich.
Update 5: (7.7.2008) Auch Henning fragt in seinem Blog jetzt: „Was erwartet ihr von der Politik im Web 2.0?“