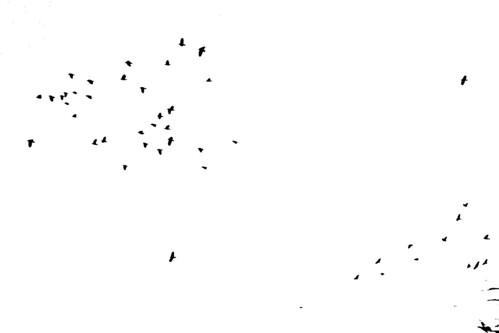Die kürzeren Tage im Dezember – bald werden sie wieder länger, und es wird wieder heller! – haben auch ihre positiven Seiten. Zum Beispiel die, am Nachmittag farbenfrohe Sonnenuntergänge angucken zu können. Mich erinnert’s an Hippie-Batik.
Kurz: Das Finale der 15. Legislaturperiode steht vor der Tür
Seltsames Gefühl: bis zur Landtagswahl sind’s noch knapp drei Monate, aber der Sitzungsbetrieb des baden-württembergischen Landtags nähert sich rapide dem Ende. Im neuen Jahr wird’s noch drei oder vier Plenartage geben. „Mein“ Wissenschaftsausschuss hat noch genau eine Sitzung. Und das Fenster, um noch Gesetze einzubringen, ist im Prinzip ebenfalls schon geschlossen (drei Lesungen und Anhörungsfristen).
Entsprechend wurden jetzt noch eine ganze Reihe von Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht – Bürgerbeauftragte und Chancengleichheit beispielsweise – oder sind in der Doppelsitzung des Landtags diese Woche beschlossen worden – Informationsfreiheitsgesetz und eGovernment-Gesetz, um auch hier zwei Beispiele zu nennen. Was jetzt nicht beschlossen wird, muss bis Ende Mai warten – erst dann sind Parlament und Landesregierung wieder voll einsatzbereit.
Und auch die Ministerien stellen jetzt noch die letzten Weichen vor der Wahl: Förderentscheidungen, Verordnungen, oder heute die Bekanntmachung des Kultusministeriums zum Informatikunterricht in allen Schularten. Wahl und Wahlkampf rücken – nach der Weihnachtspause – immer mehr in den Vordergrund. Und erst am 13. März wissen wir (vielleicht), wie es weitergeht.
Photo of the week: Winter tree I
Kurz: Vor dem Regierungsprogrammparteitag
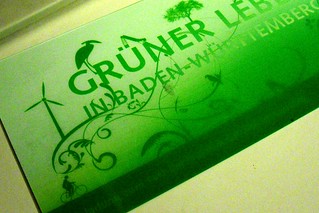 Morgen ab 11 Uhr startet unser Programmparteitag (aka „Landesdelegiertenkonferenz“ oder LDK) in Reutlingen. Der Entwurf für das grüne Wahlprogramm zur Landtagswahl 2015 in Baden-Württemberg wurde im Vorfeld intensiv diskutiert, insgesamt wurden über 400 Änderungsanträge eingereicht. Für mich ist’s insofern ein besonders spannender Parteitag, als ich an der Redaktionsgruppe beteiligt war, die den ersten Entwurf für das Programm geschrieben hat. Der lief dann durch viele Gremien, und wird auch den Parteitag noch einmal in deutlich veränderter Form verlassen. Nach zwei Wochen intensiver Verhandlungen im Vorfeld des Parteitags gibt es, ausgehend von den 400 Änderungsanträgen, jede Menge Kompromisse und Einigungen – und ein paar wenige, übriggebliebene Abstimmungen. Im Hochschulkapitel wird es beispielsweise um die Frage einer Masterplatzgarantie und darum, ob es eine Aussage zu Studiengebühren für Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland geben soll. Bei anderen Themen – etwa mehr Transparenz hinsichtlich der Hochschulhaushalte oder der Möglichkeit eines Teilzeitstudiums – hat es (modifizierte) Übernahmen gegeben. Wer es genauer wissen will, findet alle Verfahrensübersichten mit dem aktuellen Stand unter dem Link oben. Einiges wird sicherlich auch erst auf dem Parteitag ausverhandelt werden.
Morgen ab 11 Uhr startet unser Programmparteitag (aka „Landesdelegiertenkonferenz“ oder LDK) in Reutlingen. Der Entwurf für das grüne Wahlprogramm zur Landtagswahl 2015 in Baden-Württemberg wurde im Vorfeld intensiv diskutiert, insgesamt wurden über 400 Änderungsanträge eingereicht. Für mich ist’s insofern ein besonders spannender Parteitag, als ich an der Redaktionsgruppe beteiligt war, die den ersten Entwurf für das Programm geschrieben hat. Der lief dann durch viele Gremien, und wird auch den Parteitag noch einmal in deutlich veränderter Form verlassen. Nach zwei Wochen intensiver Verhandlungen im Vorfeld des Parteitags gibt es, ausgehend von den 400 Änderungsanträgen, jede Menge Kompromisse und Einigungen – und ein paar wenige, übriggebliebene Abstimmungen. Im Hochschulkapitel wird es beispielsweise um die Frage einer Masterplatzgarantie und darum, ob es eine Aussage zu Studiengebühren für Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland geben soll. Bei anderen Themen – etwa mehr Transparenz hinsichtlich der Hochschulhaushalte oder der Möglichkeit eines Teilzeitstudiums – hat es (modifizierte) Übernahmen gegeben. Wer es genauer wissen will, findet alle Verfahrensübersichten mit dem aktuellen Stand unter dem Link oben. Einiges wird sicherlich auch erst auf dem Parteitag ausverhandelt werden.
Ich kenne mich da nicht so genau aus, aber ich glaube, andere Parteien gehen mit Änderungsanträgen anders um. Das fängt schon dabei an, dass bei uns nicht nur Kreisverbände und Landesarbeitsgemeinschaften antragsberechtigt sind, sondern auch mindestens zehn einzelne Mitglieder (egal, ob delegiert zur LDK oder nicht). Auch das erklärt die große Zahl an Änderungsanträgen. Die Antragskommission kann zu diesen Anträgen letztlich nur drei Dinge empfehlen: Übernahme (d.h. Aufnahme in den Programmtext ohne Einzelabstimmung), „modifizierte Übernahme“ (nach Verhandlungen mit den Antragsteller*innen wird nicht der eigentliche Änderungsantrag, sondern z.B. eine gekürzte und abgeschwächte Version, die aber die Intention der Antragsteller*innen trifft, in das Programm aufgenommen) sowie Abstimmung (die rund 200 Delegierten entscheiden, ob der Änderungsantrag ins Programm kommt oder nicht). In diesem Prozess kann es dazu kommen, dass Anträge als „erledigt“ gekennzeichnet werden können, weil z.B. ein ähnlicher Änderungsantrag übernommen wurde, und dass Antragsteller*innen ihre Anträge zurückziehen (die Gründe dafür sind individuell höchst unterschiedlich). Was die Antragskommission nicht kann, was aber z.B. bei der SPD gang und gebe ist, ist eine Nichtbefassung oder eine Überweisung an ein anderes Parteiorgan oder an die Fraktion zu erzwingen.
Insofern sieht die Parteitagsregie auch rund zehn Stunden für die Aussprachen und Abstimmungen zu den einzelnen Programmteilen vor. Im Ergebnis wird’s ein arbeitsreicher Parteitag, bei dem am Schluss ein Programm steht, das auf Ideen aus einem Beteiligungsprozess – intern wie extern – basiert, viele Runden durch Parteigremien gedreht hat und auch morgen und übermorgen noch einmal an vielen Stellen ergänzt, verändert und überarbeitet wird. Danach haben wir dann eine ausführliche und inhaltlich gute Grundlage für den Wahlkampf und für hoffentlich anstehende Koalitionsverhandlungen. Und weil wir mit ruhiger Hand an das Anknüpfen wollen, was in dieser Legislaturperiode erreicht wurde, hat sich die Tonalität im Vergleich zum letzten Programm deutlich verändert: Es geht jetzt eher darum, Begonnenes fortzusetzen und darauf aufzubauen als um das große Fensteraufreißen, das in Baden-Württemberg vor fünf Jahren noch dringend notwendig war.