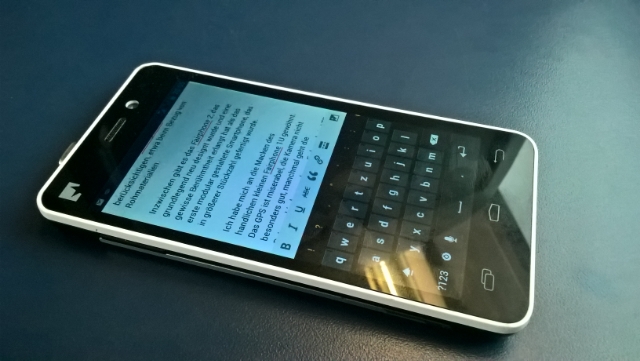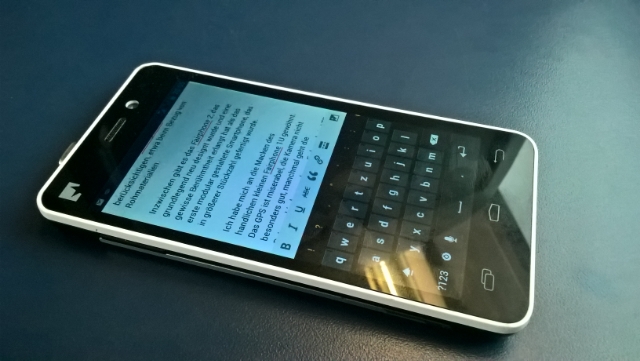Ich habe heute die Ausstellung „Together! Die Neue Architektur der Gemeinschaft“ im Vitra Design Museum in Weil besucht. Auch wenn der Wow!-Effekt fehlte, ist’s eine gut gemachte Ausstellung zu gemeinschaftlichem Wohnen und der dazugehörigen Architektur.
Das Vitra Design Museum ist halbwegs übersichtlich; die Ausstellung ist auf vier Räume aufgeteilt: Utopie – Architekturmodelle – Innensicht – Projekte. Die Utopie fängt im 18./19. Jahrhundert mit Arbeitersiedlungen und der Phalanstère Fouriers, aber auch mit US-amerikanischen Appartment-Hotels, an. Die aufgebauten Architekturmodelle erläutern (unter Rückgriff auf Farbcodes von Le Corbusier), wie sich Privatheit und (Halb-)Öffentlichkeit in verschiedenen Bauprojekten und Entwürfen begegnen. Das Zimmer zur Innensicht simuliert gemeinschaftliches Wohnen – so ein bisschen wirkt es wie ein begehbarer Ikea-Katalog. Nett sind hier die Details, etwa die Hartz-IV-Selbstbau-Möbel im Gemeinschaftsraum, die Literaturauswahl im Bücherregal oder das sorgsam arrangierte Chaos in Emils Kinderzimmer. Im vierten Raum schließlich werden einige Projekte an Schreibtischen im Detail vorgestellt – was waren die Ideen, wie wurden sie realisiert, wo gab’s Hürden. Auch das ist nett gemacht.
Das war’s dann auch schon. Für meinen Geschmack lag der Blick etwas zu sehr auf der Architektur, und zu wenig auf der sozialen Seite der Neuen Architektur der Gemeinschaft. Das Scheitern der Utopien beispielsweise fehlte, soweit ich das wahrgenommen habe, ebenso wie eine vertiefte Auseinandersetzung mit der mit solchen Wohnprojekten immer verbundenen Frage nach öffentlich/privat, aber auch nach Inklusion und Exklusion (kommt am Rand bei den Projektschreibtischen vor, aber eben auch nur am Rand). Eine weitere Leerstelle waren aus meiner Sicht „intentional communities“. Einige der dargestellten Utopien und Projekte gehen in die Richtung, aber richtig vor kamen weder Klöster noch Ökodörfer noch Landkommunen. Und Nachhaltigkeit und Commons spielte auch nur am Rand eine Rolle. Da wäre mehr möglich gewesen.
Die Ausstellung läuft noch bis 10.9., Eintritt 11 €. Website.